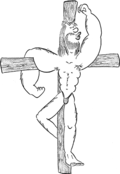Gärtners kritisches Sonntagsfrühstück: Diskurse in dieser Gesellschaft
 Im Frankfurter Hauptbahnhof stößt ein Mann ein Kind und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE. Die Mutter kann sich retten, das Kind stirbt, und abends steht die Tagesthemen-Frau Atalay im Fernsehen und hat einen Aufmacher: „Es gibt Verbrechen, die uns so erschüttern, dass sie uns fast die Sprache verschlagen“, am Stammtisch etwa oder in den Tagesthemen, aber eben nur fast. „Der mutmaßliche Täter ist ein 40jähriger aus Eritrea. … So steht die Öffentlichkeit fassungslos vor Taten, die nicht zu begreifen sind“, schon gar nicht einen halben Tag nachdem die Taten überhaupt erst passiert sind. Da es fürs erste nichts zu begreifen gibt, kann der Filmbeitrag auch nur den Sachverhalt schildern, der Eritreer ist festgenommen und schweigt. Später wird ein Psychiater ihn begutachten.
Im Frankfurter Hauptbahnhof stößt ein Mann ein Kind und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE. Die Mutter kann sich retten, das Kind stirbt, und abends steht die Tagesthemen-Frau Atalay im Fernsehen und hat einen Aufmacher: „Es gibt Verbrechen, die uns so erschüttern, dass sie uns fast die Sprache verschlagen“, am Stammtisch etwa oder in den Tagesthemen, aber eben nur fast. „Der mutmaßliche Täter ist ein 40jähriger aus Eritrea. … So steht die Öffentlichkeit fassungslos vor Taten, die nicht zu begreifen sind“, schon gar nicht einen halben Tag nachdem die Taten überhaupt erst passiert sind. Da es fürs erste nichts zu begreifen gibt, kann der Filmbeitrag auch nur den Sachverhalt schildern, der Eritreer ist festgenommen und schweigt. Später wird ein Psychiater ihn begutachten.
Weil aber die Öffentlichkeit gerade so schön fassungslos ist, widmet sich gleich der nächste Beitrag der wachsenden Zahl von Fällen, in denen „junge Männer, die oft einen Migrationshintergrund haben“, im Freibad randalieren. „Pauschale Vorverurteilungen lehnen Experten ab“, relativiert der Filmbericht weiter, „nicht immer handele es sich zum Beispiel um Jugendliche mit einem Migrationshintergrund“, und trotzdem wollen Politiker natürlich Aufenthaltsrechte prüfen und hat ein Schwimmbad einen iranischen Bademeister eingestellt. Dessen Chef sagt: „Die Südländer ham ne andere Mentalität als wir Deutschen, und wenn man da jemand hinschickt, der die gleiche Sprache spricht, kann man das schnell aufn Teppich wieder zurückholen.“
Da Vorverurteilungen mithin abzulehnen sind und es sich nicht immer, sondern nur oft um junge Männer mit Migrationshintergrund handelt, spricht Atalay dann „mit dem Integrationsexperten und Psychologen Ahmed Mansour“, der wie immer und sehr gekonnt vor pauschalen Urteilen warnt, um sie dann doch zu servieren. Frage: „Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach der Migrationshintergrund der jungen Männer?“ – „Eine Rolle von vielen. Also, viele Migranten, die zu uns kommen, bringen ganz andere Sozialisationen mit, patriarchalische Strukturen, Männlichkeitsbilder, die natürlich auch in Extremfällen zu Gewalt führen. Gewalt, die wir in den letzten Tagen erlebt haben, hat nicht nur mit Flüchtlingen und Migration zu tun, sondern auch mit Jugendkultur, mit den Diskursen in dieser Gesellschaft, die aggressiver geworden sind.“
Bei soviel Übersicht muss Atalay aufpassen, dass Ihr schönes Interview keine falsche Richtung nimmt, und fragt also nicht nach dem gesamtgesellschaftlichen Aggressionsdiskurs, in dem kurzbehoste deutsche Kleinbürger z.B. zu pöbeln anfangen, nur weil im Fahrradmarkt die Reparaturannahme ausnahmsweise nicht unterm Schild „Reparaturannahme“ stattfindet, sondern lieber nach den ausländerrechtlichen Konsequenzen und ob die denn hülfen. Mansour weiß, was verlangt wird: „Bei manchen Fällen ist das natürlich sehr gut, einfach die Rechtsstaatlichkeit konsequent durchzuziehen, und auch denjenigen, die zu uns kommen, die Gastfreundschaft, die Asyl sozusagen ausnutzen, instrumentalisieren, um hier Gewalt auszuleben, einfach die Konsequenzen auch zu zeigen und sie mit Botschaften auch abschieben zu können.“ Etwa einer Botschaft wie: Wer das Gastrecht, das es gar nicht gibt, ausnutzt, um sich im Freibad danebenzubenehmen, der muss sich in Afghanistan dann halt ggf. hinrichten lassen. „Das Problem, das wir in den letzten Jahren erleben“, gerade wenn wir die „Bild“-Zeitung lesen, „ist, dass der Rechtsstaat einfach als schwach wahrgenommen wird, und in manchen Fällen wären solche Botschaften sehr notwendig, um den Jugendlichen einfach zu zeigen, dass Gewalt kein Bagatelldelikt ist, dass das bestraft wird und in Extremfällen auch mit Abschiebung bedroht wird.“ Einem Extremfall wie dem von Düsseldorf, wo sich hundert junge Blödmänner mit den Bademeistern anlegten.
„Doch weil ich dich hier nicht versteh, / Leiste ich Gesellschaft dir nicht und geh / Verloren traurig ist sie schon / Unsere bittersüße Non-Konversation.“ Keimzeit, 2000
Aber da wollen wir, will Atalay ja hin: dass, wer rechtzeitig abgeschoben ist, nichts mehr anstellen kann. „In Voerde stieß ein Mann eine Frau vor einen Zug, auch er hat Migrationshintergrund.“ Laut SZ vom Folgetag ist der Täter von Voerde ein „in Deutschland geborener Kosovo-Serbe“ und hat also einen sozusagen blutsmäßigen Migrationshintergrund und eine andere Mentalität als Südländer. „In der öffentlichen Wahrnehmung kommt an, unfassbare Taten, begangen von Menschen mit ausländischen Wurzeln“, barmt Atalay, deren Dummheit sie vor dem Vorwurf bewahren mag, eine Heuchlerin zu sein. „Nun frag ich mich als die, die darüber berichtet“, und zwar so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ankommt, unfassbare Taten, begangen von Menschen mit ausländischen Wurzeln, „was macht das mit unserer Gesellschaft, mit dem Umgang mit solchen Taten? – „Also erst mal sind das Realitäten“, hilft Mansour gern, „die vielen Menschen angst machen. Der zweite Schritt wäre, zu differenzieren und einfach den Rechten die Argumente wegzunehmen“, auch durch Abschiebungen im Extremfall. Der dritte: „Wir müssen diese Debatte führen, wir können sie nicht tabuisieren, die Tabuisierung wird dazu führen, dass die Rechten davon profitieren.“
Im Anschluss an die Tagesthemen ein Report über Polizeigewalt in Deutschland: 2000 Fälle werden Jahr für Jahr angezeigt, davon landen 40 vor Gericht, 20 enden mit einer Verurteilung, die Dunkelziffer wird auf 12 000 Fälle geschätzt. Vermutet werden dürfen patriarchalische Strukturen, Männlichkeitsbilder, die natürlich auch in extremen Fällen zu Gewalt führen. Geradezu sehr vielen.





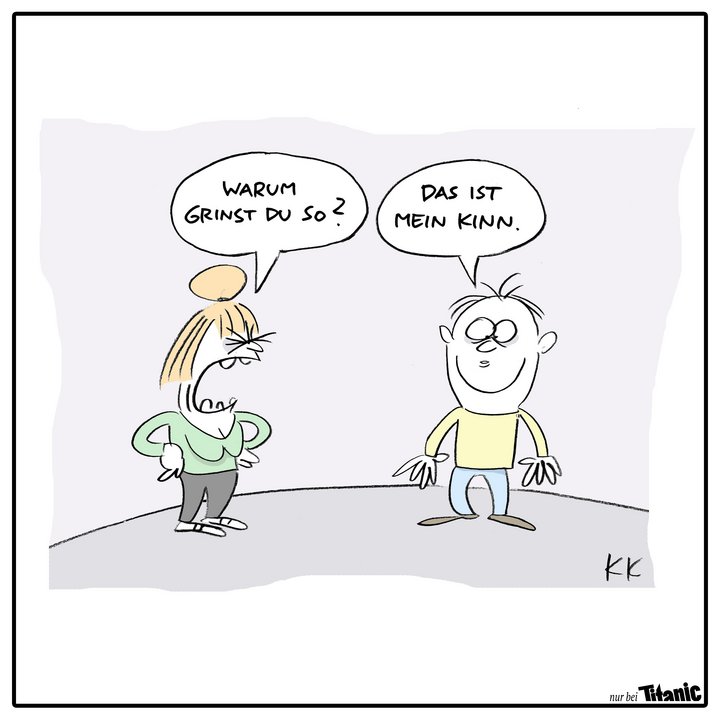














 Hä, »Spiegel«?
Hä, »Spiegel«?