Gärtners kritisches Sonntagsfrühstück: Wegwerfgesellschaft
 Unsere immer schnellere Zeit, notierte SZ-Mann Cornelius Pollmer neulich, lässt sich schlicht nicht bremsen, und deshalb ließ er auch ein gewisses Verständnis durchblicken für Ostdeutsche, die sozusagen für Entschleunigung gestimmt haben. Dabei ist das mit dem Tempo, der Hatz und der Kälte gar nicht so schlimm; man muss nur ein einziges Mal bei Manufactum gekauft haben, und schon finden sich regelmäßig die wärmenden Produktkataloge im Postkasten, die zu unterhaltlichen Überlegungen der Art führen, wo denn die freistehende Kupferbadewanne noch Platz hätte.
Unsere immer schnellere Zeit, notierte SZ-Mann Cornelius Pollmer neulich, lässt sich schlicht nicht bremsen, und deshalb ließ er auch ein gewisses Verständnis durchblicken für Ostdeutsche, die sozusagen für Entschleunigung gestimmt haben. Dabei ist das mit dem Tempo, der Hatz und der Kälte gar nicht so schlimm; man muss nur ein einziges Mal bei Manufactum gekauft haben, und schon finden sich regelmäßig die wärmenden Produktkataloge im Postkasten, die zu unterhaltlichen Überlegungen der Art führen, wo denn die freistehende Kupferbadewanne noch Platz hätte.
So gut wie gleichzeitig mit dem Manufactum-Katalog kam jetzt die neue Lieferung der Werke Wolfgang Pohrts (Edition Tiamat), der erste Band, der vor allem die „Theorie des Gebrauchswertes“ enthält, von der Pohrt mal sagte, er habe im Leben nur einen Menschen getroffen, der sie zu Ende gelesen habe, und der sei Theologe gewesen. Mir ist es aus purer Zeitnot noch nicht einmal gelungen, sie richtig anzufangen, aber der ’95er Neuausgabe, die sich im Band findet, war eine Art Prolog aus dem Jahr 1973 beigegeben: „Nutzlose Welt. Ohnmacht im Spätkapitalismus“, und der Leser, die Leserin bekommen eine Ahnung davon, was es mit dem Gebrauchswert auf sich hat, wenn von dem Bann die Rede ist, „der die gegenständliche Welt in nutzloses Spielzeug verzaubert“: „Seit die Herrschaft des Kapitals kaum noch inhaltlich, sondern nur mehr negativ bestimmbar ist als Zwang, nichts Ernsthaftes und Vernünftiges zu tun, sind vernunftloser Genuss und sinnliche Freuden nicht mehr identisch mit der selbstherrlichen Emanzipation des Menschen von notwendiger Arbeit … Als Unterwerfung unter die Willkür der Apparate, welche die Menschen nur als Witzfiguren in einem Betätigungsfeld duldet, das den großstädtischen Spielplätzen ähnelt, wird die Genussfähigkeit selbst kraftlos und verkümmert.“ Und weiter: „Im Alltag der Gegenwart begegnet einem die Auflösung des Widerspruchs von Gebrauchswert und Wert dergestalt, dass kaum noch erkennbar ist, was sich mit den Dingen anderes anfangen ließe als sie verkaufen, kaufen und wegschmeißen.“
„Der Gebrauchswert ist, was den Begriffen der politischen Ökonomie entschlüpft, wenngleich diese nötig sind, damit jener gedacht werden kann. Erst wenn das Brot profitabel sein muss, um hergestellt zu werden, stellt sich die Frage nach seinem Nutzen für den Konsumenten separat.“ Pohrt, 1976/1995
Da gab es freilich Manufactum noch nicht, das den Bann zu brechen verspricht, indem es den Gebrauchswert fetischisiert, das Ewige, Unzerstörbare, bloß Praktische, wie es Großmutter noch kannte. Der Clou ist natürlich, dass sich unterm Regime des Tauschwerts kein Gebrauchswert mehr haben lässt und dieser zur Simulation wird, weil kein Mensch eine Kupferbadewanne tatsächlich braucht oder eben nur dann, wenn er der Sphäre des Brauchens längst entronnen ist. Das ostentative und vor allem ja teure Zurück zum Gebrauchswert ist in sich schon die Kapitulation vorm Wert, und deshalb sind Manufactum-Produkte, versteht sich, viel eher Wert- als Gebrauchsgegenstände.
Auf dem Stadtbus Werbung für Kieser: „Ein starker Körper bleibt jung!“ oder so, und die Überlegung, warum in einer Zeit und Gegend, da Arbeiten im Alter, auch wenn der BDI es zu ändern verspricht, regelmäßig gar nicht mehr vorgesehen ist, immerwährende Stärke und Jugend proklamiert werden. Unter Gebrauchswertgesichtspunkten ist ein Körper, der lange gesund und arbeitsfähig ist, erstrebenswert; soll er gesund und arbeitsfähig bleiben, ohne dass es das brauchte, geht es womöglich nicht um einen goldenen Herbst, sondern um fortgesetzte Vernutzbarkeit, sei’s als symbolische, sei’s als Teil der Reservearmee, die nie groß genug sein kann: ums Verkaufen, Kaufen und Wegschmeißen gerade da, wo dem Weggeschmissenwerden als Lebensendpunkt zwei halbe Stunden pro Woche entgegengearbeitet wird. Dass im Rückenstudio, wo man sich freiwillig in die Apparate einspannt, die Genussfähigkeit geschult werde, würde Kieser selbst nicht behaupten.
Ich hoffe, diese flüchtigen Gedanken sind brauchbar; wenn nicht, bitte tauschen. Oder wegschmeißen!





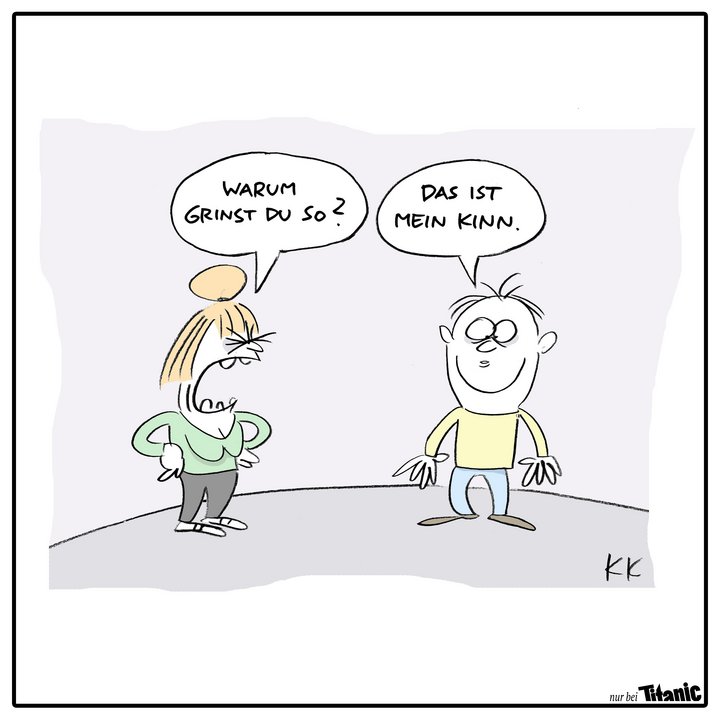














 Grüß Gott, Businesspäpstin Diana zur Löwen!
Grüß Gott, Businesspäpstin Diana zur Löwen!



