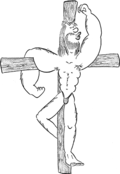Gärtners kritisches Sonntagsfrühstück: Dies und das (nicht)
 Ein Text ist ja immer alle Texte, die man nicht schreibt, und also will ich mich heute nicht schon wieder des Geschreis wegen „sprachpolizeilicher Aktivitäten“ annehmen, das selbst so gebildete Männer (aber eben meistens: Männer) wie Thomas Steinfeld (SZ) und Peter Eisenberg (Linguistik) erheben, weil sich die Praxis durchsetze, „noch jedem ,Straftäter’ eine ,Straftäterin’ an die Seite zu stellen“, ach Gott; als wäre Polizei nicht das, was die Regeln durchsetzt, und wer setzt fürs Milieu die Regel durch, daß gemischtgeschlechtliche Gruppen unters männliche Rubrum fallen? Herr Steinfeld und Herr Eisenberg. Bin ja selbst Sprachpolizist (wenn auch einer ohne Knarre und Mandat), und ich erkenne einen, wenn ich ihn sehe. Und was den „zunehmend ideologischen Gebrauch der Sprache“ angeht, könnte Steinfeld zunächst einen Zettel in die Redaktion hängen lassen mit jenem zunehmend, sogar „massiv“ (Steinfeld) hirnverengenden Orwell-Vokabular, das seine Zeitung erst mal meiden soll, bevor’s wieder gegen irgendwelche Genderfaschist*innen geht.
Ein Text ist ja immer alle Texte, die man nicht schreibt, und also will ich mich heute nicht schon wieder des Geschreis wegen „sprachpolizeilicher Aktivitäten“ annehmen, das selbst so gebildete Männer (aber eben meistens: Männer) wie Thomas Steinfeld (SZ) und Peter Eisenberg (Linguistik) erheben, weil sich die Praxis durchsetze, „noch jedem ,Straftäter’ eine ,Straftäterin’ an die Seite zu stellen“, ach Gott; als wäre Polizei nicht das, was die Regeln durchsetzt, und wer setzt fürs Milieu die Regel durch, daß gemischtgeschlechtliche Gruppen unters männliche Rubrum fallen? Herr Steinfeld und Herr Eisenberg. Bin ja selbst Sprachpolizist (wenn auch einer ohne Knarre und Mandat), und ich erkenne einen, wenn ich ihn sehe. Und was den „zunehmend ideologischen Gebrauch der Sprache“ angeht, könnte Steinfeld zunächst einen Zettel in die Redaktion hängen lassen mit jenem zunehmend, sogar „massiv“ (Steinfeld) hirnverengenden Orwell-Vokabular, das seine Zeitung erst mal meiden soll, bevor’s wieder gegen irgendwelche Genderfaschist*innen geht.
Was ich hier auch nicht leisten will, ist, dem alten Adorniten, in dessen Mailverteiler ich (was gar nicht stört) geraten bin, den Wunsch zu erfüllen, es möge endlich mal einer den Oliver Welke und seine „Heute Show“ abwatschen, denn erstens hat das Kollege Mentz bereits getan („ein Eventmanager vom Sportfernsehen“), und zweitens bin ich mir nicht sicher, ob mir Welke nicht sogar ein bißchen leid tut. Er tut so gerne, was er tut, man sieht’s ihm an, aber er weigert sich zu sehen – oder sieht es ganz im Ernst nicht –, daß es auf der Welt nichts Affirmativeres, herrschaftsideologisch Aufgeladeneres gibt als Sport/Fußball und daß es, nicht moralisch, sondern handwerklich, nicht aufgehen kann, wenn ein Champions-League-Grüßaugust (und sei’s ein freundlicher) Satire gegen die da oben vorträgt. „Drei Mann in einem Raum, da ist schlecht Fotze lecken“ (Helge Schneider). Es geht schlicht nicht.
„Was ich nicht loben kann, / davon sprech ich nicht.“ Goethe, 1827
Und weil ich das alles nicht ausführen mag, bleibt glücklich Zeit, um mich auch einmal zu freuen, über ein Wunder fast, das freilich bloß ein Korrespondentenwechsel ist und jedenfalls dafür sorgt, daß der Gazastreifen plötzlich nicht mehr allein unterm perfiden Juden leidet: „Trotz des jüngsten Versöhnungsabkommens zwischen Fatah und Hamas: Die Lage in Gaza bleibt hoffnungslos. Bei der Übergabe der Verwaltung hakt es, viele Menschen warten seit Monaten vergeblich auf ihr Gehalt. … Der politische Analyst Talal Okal ... sieht die Schuld an der derzeitigen Verzögerung eher in Gaza … Die Autonomiebehörde zahle weiter die Stromrechnungen nicht, so daß es nur drei Stunden am Tag Elektrizität gebe. Auch hinter Okals Haus brummt ein kastengroßer Generator, mit dem drei Dutzend Haushalte versorgt werden – zum siebenfachen Preis des öffentlichen Stroms. Die Straßen sind Pisten, über welche Autos und noch mehr Eselskarren holpern. Asphalt gibt es in dieser Stadt mit rund einer halben Million Einwohnern nicht überall, dafür jede Menge tischgroße Schlaglöcher. Viele Gebäude stehen leer, die zehn Kinos der Stadt sind Brandruinen – von Hamas-Anhängern gestürmt. Auch das Museum und die Bibliothek sind zu. Dafür steht alle paar hundert Meter eine Moschee – nagelneu, von Katar finanziert. Rund ein Drittel der Frauen auf den Straßen trägt Niqab, den Gesichtsschleier.“
So sieht er also aus, der Freiheitskampf, und sogar seine Profiteure lernt man kennen; und da ich ja heut’ so viel nicht habe aufschreiben müssen, grüße ich die neue Israel-Korrespondentin der „Süddeutschen Zeitung“ Alexandra Föderl-Schmid. Ihr Vorgänger Peter Münch ist jetzt in Wien; kann er ja mit Strache mal essen gehen.




















 Wir wollten, »SZ«,
Wir wollten, »SZ«,