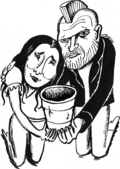Gärtners kritisches Sonntagsfrühstück: Mit viel unscharf, bitte
 Daß ich in sprachlichen Dingen durchaus idiosynkratisch, vielleicht sogar obsessiv bin, ist bekannt. Bekannt ist hoffentlich auch, daß das nicht sowohl ästhetische als moralische Gründe hat; daß, wer, zum Beispiel, überall das Etikett „spannend“ draufklebt, nicht nur ein Banause ist, sondern einer, der, indem er der Phrase vor der Nuance den Vorzug gibt, der Unwahrheit allen Vorschub leistet.
Daß ich in sprachlichen Dingen durchaus idiosynkratisch, vielleicht sogar obsessiv bin, ist bekannt. Bekannt ist hoffentlich auch, daß das nicht sowohl ästhetische als moralische Gründe hat; daß, wer, zum Beispiel, überall das Etikett „spannend“ draufklebt, nicht nur ein Banause ist, sondern einer, der, indem er der Phrase vor der Nuance den Vorzug gibt, der Unwahrheit allen Vorschub leistet.
Ich danke wiederum der verläßlichen Süddeutschen Zeitung, daß sie mir Gelegenheit gibt, die Sache zu illustrieren:
Am Tag nach der Verurteilung des Kassenwarts von Auschwitz erscheint auf Seite 1 der SZ ein Artikel unter den Zeilen: „Vier Jahre Haft im Auschwitz-Prozeß. Gericht verbindet sein Urteil gegen den 94jährigen Oskar Gröning mit harscher Kritik an der deutschen Nachkriegsjustiz“. Es ist ein altes Bemühen von mir, die automatisierte, dem Krawall geschuldete Kopplung des Hauptworts „Kritik“ mit den Adjektiven „scharf“ und „harsch“ als schädlich auszuweisen, und wir sehen, warum: „Harsche Kritik übte (Richter) Kompisch an der jahrzehntelangen Praxis der deutschen Justiz, nur die direkte Mitwirkung an einer Tötungshandlung als Beihilfe zum Mord zu bewerten. Das sei vergleichbar mit dem, was bei der Planung der Konzentrationslager geschehen sei. ,Man hat das Gesamtgeschehen zergliedert und in Einzelteile zerlegt. Das war eine, wie wir finden, seltsame Rechtsprechung’, sagte Kompisch. Das Gericht wolle aber ,nicht den Stab über verstorbene Kollegen brechen’.“
„Abgesehen davon, daß es keinen unpolitischen Strafprozeß gibt, weil in der Welt überhaupt nichts unpolitisch ist, darf gesagt werden, daß wir eine Rechtsprechung und eine Rechtsfindung bei politischen Tatbeständen nicht haben.“ Tucholsky, 1927
Es gibt bei der Frage, wo der Geltungsbereich des Epithetons „harsch“ beginnt, sicher einen Ermessensspielraum; daß die Einschätzung, eine Rechtsprechung sei „seltsam“, wobei man aber über die für die Seltsamkeiten Verantwortlichen „nicht den Stab brechen“ wolle, in Tat und Wahrheit „harsche Kritik“ sei, wird man indes nicht annehmen können. Es ist gelogen, und zwar nicht auf die Art, wie Leute, die „Lügenpresse“ sagen, glauben, daß die Presse lügt, nämlich irgendwie infam, listig oder hinterrücks, jedenfalls irgendwie jüdisch, nein: es ist so dumm gelogen, daß der Verdacht naheliegt, hier habe die bekannte Automatik gewaltet, die „Kritik“ nur mehr als scharfe oder harsche kennt, nicht etwa auch als vorsichtige, verhohlene, subtile oder gar feige.
Wie, was die deutsche Nachkriegsjustiz angeht, „harsche“ Kritik aussieht – für Leute, die sich vor Phrasen ekeln: strenge, genaue, unerbittliche, beißende, entschlossene, wütende, bittere Kritik –, läßt sich in Ingo Müllers „Furchtbare Juristen“ nachlesen, einem Buch, das ich hier gern noch einmal und immer wieder empfehle, weil es nämlich der Phrase vom „Versagen“ dieser Justiz alle Grundlage entzieht. (Noch unverschämter abermals die SZ, die neulich davon schrieb, die Justiz nach dem Krieg habe in NS-Belangen „geschlafen“.) Denn es gab kein Versagen: Fast alle furchtbaren Nazirichter blieben nach 1945 Richter. Krähen sollten anderen Krähen ans Auge gehen, und eigentlich sollten sie gar nicht. Denn aus Nazideutschland war ein Deutschland voller Nazis geworden, in Presse, Politik, Wirtschaft und Justiz. Noch 1985 – da hat der Geschichtsklitterer Weizsäcker den SA-Mann Carstens gerade als Bundespräsident abgelöst, der Kanzler besucht in ehrender Absicht einen SS-Friedhof, und die Annullierung von NS-Urteilen gegen Deserteure und „Wehrkraftzersetzer“ ist noch 17 Jahre hin – wird ein Ermittlungsverfahren gegen Gröning eingestellt. Ohne Kritik von irgendwem.
Schon seltsam, wenngleich hier nicht der Stab gebrochen sei; nicht daß wir in den Verdacht gerieten, wir übten Kritik, die als harsche ihr genaues Gegenteil ist.
| ◀ | Riegel am Sonntag (Klickcomic) | Versager der Geschichte (XIX) | ▶ |















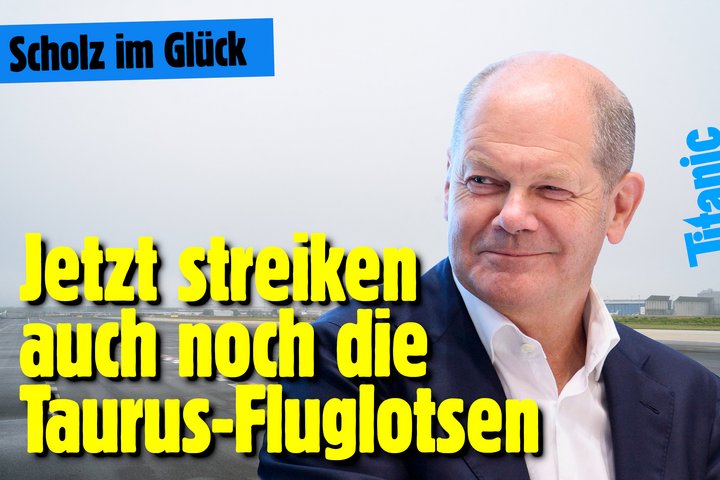

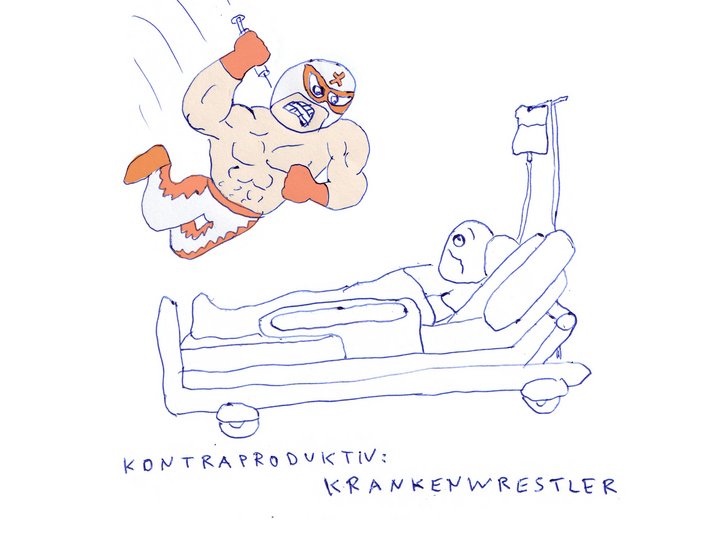


 Boah ey, Natur!
Boah ey, Natur!