Gärtners kritisches Sonntagsfrühstück: Keine Chance
 Wieder einmal Henscheids „Maria Schnee“ gelesen, doppelte Glücksempfindung gehabt: einmal, weil das Buch so schön ist und noch viel schöner als bei der Erst- bis Drittleküre war (auch für Bücher muß man im richtigen Alter sein, und für „Maria Schnee“ bin ich’s jetzt), zum anderen, weil ich fand, daß alles, was mir vor bald zwanzig Jahren in meiner Examensarbeit dazu eingefallen war, sich als immer noch richtig und stichhaltig erwies, ich sogar Sätze sah, die, damals überlesen, mein „Gewäsch“ (Zweitgutachter Dr. Sch., sinngemäß) ganz wunderbar bestätigten. So daß mich einen halben Tag lang der Gedanke umtrieb, das mit dem Schriftstellern eine Weile sein zu lassen und lieber (mittels „Maria Schnee“) den Doktor nachzuholen.
Wieder einmal Henscheids „Maria Schnee“ gelesen, doppelte Glücksempfindung gehabt: einmal, weil das Buch so schön ist und noch viel schöner als bei der Erst- bis Drittleküre war (auch für Bücher muß man im richtigen Alter sein, und für „Maria Schnee“ bin ich’s jetzt), zum anderen, weil ich fand, daß alles, was mir vor bald zwanzig Jahren in meiner Examensarbeit dazu eingefallen war, sich als immer noch richtig und stichhaltig erwies, ich sogar Sätze sah, die, damals überlesen, mein „Gewäsch“ (Zweitgutachter Dr. Sch., sinngemäß) ganz wunderbar bestätigten. So daß mich einen halben Tag lang der Gedanke umtrieb, das mit dem Schriftstellern eine Weile sein zu lassen und lieber (mittels „Maria Schnee“) den Doktor nachzuholen.
Mutatis mutandis ähnlich mag’s jetzt dem Soziologen Oliver Nachtwey gegangen sein, der den Doktor freilich schon hat und in seinem Buch „Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne“ (Suhrkamp) die „radikalisierte Chancengleichheit“ in der „prekären Vollerwerbsgesellschaft“ kritisiert: Gerechtigkeit bedeute nämlich längst nicht mehr „den Ausgleich vertikaler Ungleichheiten als vielmehr in erster Linie die Verringerung horizontaler Diskriminierungen entlang kultureller Merkmale. Die Schlüsselbegriffe dieses Gerechtigkeitsdiskurses sind nicht mehr soziale Ungleichheit und Ausbeutung, sondern Gleichberechtigung und Identität.“ Natürlich sei gegen z.B. den gleichberechtigten Zugang von Frauen zu Führungspositionen nichts zu sagen, doch verschärfe sich das Problem in der Vertikalen: „Auch in einem formal chancengleichen System bleiben die Aussichten für die Kinder reicher und gebildeter Eltern am Ende besser. Über Seilschaften und Startvorteile können Privilegien unsichtbar vererbt werden“, und Bourdieus feine Unterschiede sorgen dafür, daß oben meist wieder nur „die Kinder der Eliten“ landen.
„Hermann war nahe dran, sich nach dem Tier zu erkundigen, welches hinter dem Schranke wohnte, es kribbelte in ihm, doch unter allen Umständen wollte er das Tier ja vergessen und nicht gesehen haben.“ Henscheid, 1988
Chancengleichheit sei „das Gerechtigkeitsprinzip einer individualisierten Gesellschaft, denn mit ihr werden Autonomie, Eigenverantwortung und Selbstverwirklichung radikalisiert, die Konkurrenz der Individuen innerhalb und zwischen den Gruppen wird erhöht, und schließlich werden soziale und solidarische Bindungen untergraben“ – mit dem heiklen (auch von Franz Walter schon notierten) sozialpsychologischen Effekt, daß die Dummen, die ihre Chance nicht genutzt haben, nicht mehr auf die Idee kommen, jemand anderes als sie selbst könnte am eigenen Scheitern schuld sein. „Kurzum: Je mehr eine Gesellschaft auf Chancengleichheit setzt, desto ungleicher wird sie, und desto legitimer werden die Ungleichheiten. Zwar wird die Gültigkeit des Leistungsprinzips immer weiter abgeschwächt, doch haben weiterhin alle die (vermeintlich) gleichen Chancen: Die Verlierer sind dadurch die verdienten Verlierer und die Gewinner die verdienten Gewinner.“
So. Und nach all dem liest Dr. Nachtwey nun vielleicht auf Spiegel online von der Umfrage des Allensbach-Instituts, wonach „die sogenannte Generation Mitte“, also die Deutschen zwischen 30 und 59 Jahren, erstens zufrieden mit ihrer Lage ist und zweitens aber findet, „daß Vermögen und Einkommen in Deutschland unfair verteilt sind. Höhere Steuern für Reiche und mehr Geld für Arme lehnt sie aber ab. Was denn nun?“ Der Widerspruch löst sich auf, wenn wir das zur Chancengerechtigkeit Gesagte ernstnehmen, denn zwar wird „der Zugang zu Bildung und dem Gesundheitssystem von einer übergroßen Mehrheit als Gradmesser für eine sozial gerechte Gesellschaft angesehen“, mithin: gleiches Chancenrecht für alle! „Grundsätzlich haben die 30- bis 59jährigen jedoch wenig Probleme mit Ungleichheit – solange diese auf die eigene Leistung zurückzuführen ist. Im Gegenteil, sie fordern sogar deutliche Unterschiede als Ausdruck von Gerechtigkeit“, denn die Chance auf Lohn durch Leistung hat ja jede/r, und wem es besser geht, dem geht es verdientermaßen besser. „Arm und Reich sollen sich annähern – aber ohne Umverteilung. Die Gesellschaft soll sozial gerechter werden – aber die Einkommen sollen sich deutlich unterscheiden. Die Generation Mitte, sie ist auch eine ,Generation Zwiespalt’.“
Schön (und sowieso pro domo) gesagt. Richtig ist vermutlich, daß, wer profitiert, nicht will, daß es sich ändert, egal was er sonst noch findet. Bigott moralisierend dem Vorteilsprinzip das Wort reden: es ist kein Wunder, daß sie alle ihren Gauck so lieben.
| ◀ | An der Kasse | Erotik-Klassiker, die sich nicht durchgesetzt haben | ▶ |




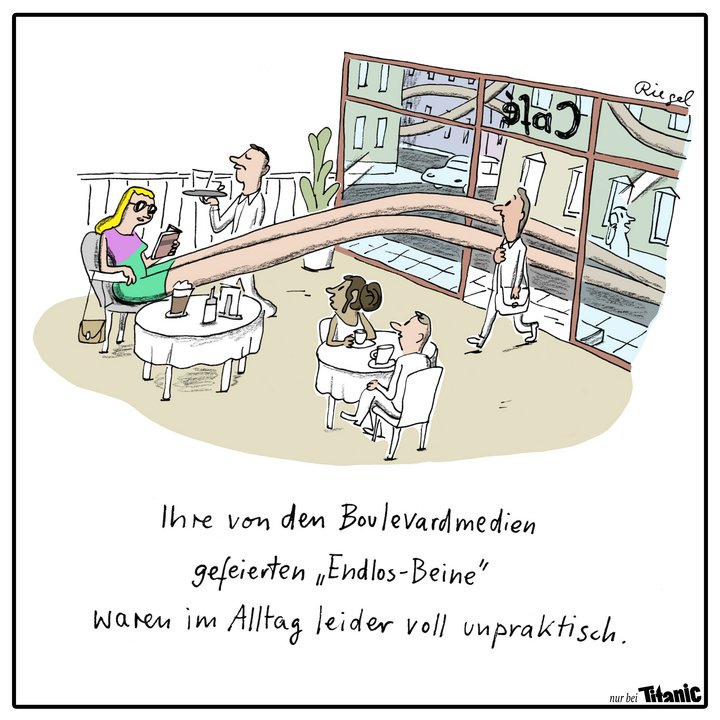












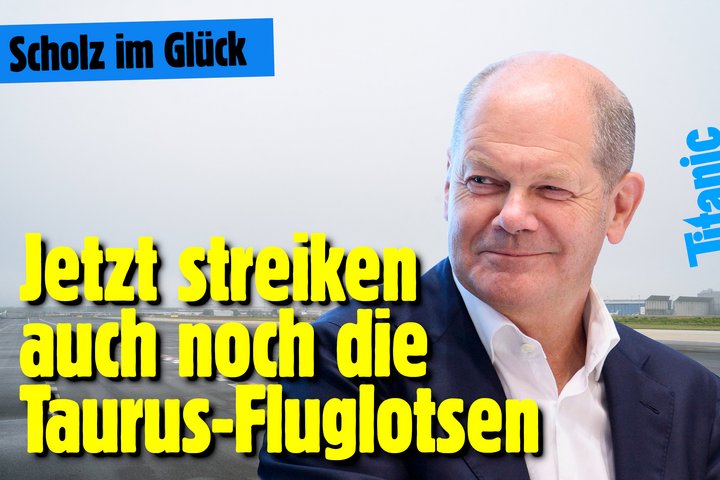


 Dear Weltgeist,
Dear Weltgeist,



