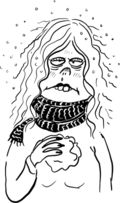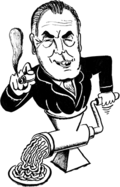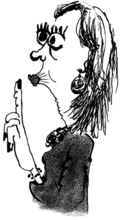Humorkritik | Oktober 2007
Oktober 2007
Comic-Klassiker
Ob er ein Seemann sei, ruft Castor Oil einem im Hafen herumlungernden Typen mit verkniffenem Gesichtsausdruck zu. »Seh ich etwa aus wie’n Cowboy?« knurrt dieser zurück.
Diese Szene spielte sich im Januar 1929 in den paar Zeitungen ab, die E. C. Segars leidlich erfolglosen Comicstrip »Thimble Theatre« (Fingerhuttheater) abdruckten – seither kennt alle Welt den grantigen Seemann mit den kräftigen Unterarmen und der Vorliebe für Spinat. Oder auch nicht. Die meisten kennen nur die Werbe-Franchisefigur Popeye, die noch heute zwei Milliarden Dollar pro Jahr umsetzt, nicht aber das Original, dessen Abenteuer E. C. Segar bis zu seinem frühen Tod 1938 zeichnete.
Popeye war eine Sensation. Ein zutiefst häßliches, einäugiges Rauhbein, dessen Sprechweise jeglicher Syntax Hohn sprach und das, wenn er nicht weiterwußte, die Fäuste fliegen ließ. Popeye lebte nach seinem Wahlspruch »I yam what I yam and that’s what I yam«, nichts und niemand konnte ihn vom einmal eingeschlagenen Weg abbringen, er war fintenreich genug, um auch seine härtesten Widersacher übers Ohr oder k. o. zu hauen, und wenn es denn sein mußte, verdrosch er auch mal eine Frau oder ließ seine Gespielin Olive für ein kesseres Weibsbild stehen.
E. C. Segars Witz, gleichermaßen geprägt vom Vaudeville wie vom absurden Theater, war roh, vulgär, unkorrekt, sehr physisch und abstrus und machte aus Popeye nicht nur den Retter der Spinatindustrie, sondern auch Amerikas populärsten Antihelden der Depressionsjahre.
Popeyes anarchische Anfänge wurden uns indes lange vorenthalten, denn die Vergangenheit der Comics ist so reich wie das Gedächtnis der Szene kurz. Das läßt sich nun korrigieren: Der amerikanische Verlag Fantagraphics Books arbeitet an einer Werkausgabe von Segars »Popeye«, und auch der deutsche Mare-Verlag hat unlängst eine dicke Schwarte mit Popeyes Abenteuern auf hoher See aufgelegt – kongenial übersetzt von Ebi Naumann, dem es gelungen ist, die als unübersetzbar geltende Sprache einzudeutschen: »Ich pin, wass ich pin – wer pinnich tenn?!«
Auch George Herrimans »Krazy Kat« gilt als unübersetzbar, und deshalb greife der interessierte Leser klassischer Comics gar nicht erst zu den kläglich gescheiterten deutschen Übertragungen, sondern zur amerikanischen Ausgabe der Sonntagsseiten, die der Fantagraphics Verlag jetzt unter dem Titel »Krazy and Ignatz« herausgibt.
»Krazy Kat«, der ewige Klassiker, ist so simpel wie genial: Die liebenswerte, verrückte Katze liebt die Maus Ignatz, die ihrerseits die Katze mit Pflastersteinen beschmeißt, was diese wiederum als Liebesbeweis auffaßt. Und der Hund, Offisa Pupp, heimlich in Krazy verliebt, will die Katze vor den Angriffen der Maus beschützen und sperrt Ignatz bei jeder Gelegenheit in den Knast. Diese Situation wird auf jeder Seite durchgespielt, aber nie hat man den Eindruck, daß sich etwas wiederhole – die Situation ist surreal genug, um jedesmal neu zu wirken und sich nie abzunutzen.
Der Humor ist absurd, die Grundstimmung melancholisch, und Schadenfreude kommt trotz des Backsteins nie auf. Schließlich geht es um Liebe und gegenseitiges Mißverstehen. Aber nicht nur: Allein die Implikationen der widernatürlichen Konfiguration Hund, Katze, Maus lassen viel Spielraum für politische, philosophische, sentimentale, erotische, poetische und soziale Spannungen, die Herriman allerdings nie expliziert – sie schwingen nur unterschwellig mit und machen »Krazy Kat« zum anarchistischen Comic par excellence.
Zu absurd, um kommerziell erfolgreich zu sein, erfreute sich der Katzencomic, den Herriman von 1913 bis 1944 zeichnete, der Bewunderung so prominenter Zeitgenossen wie Picasso, Gertrude Stein, T.S. Eliot und anderer; und der Pressemagnat William Randolph Hearst war so vernarrt in den Strip, daß er Herriman kurzerhand zum bestbezahlten Zeichner seiner Zeit machte – obschon kaum eine Zeitung diesen Quotenkiller freiwillig abdruckte. Das ist vermutlich eine der wenigen wirklich sympathischen Geschichten, die sich über Hearst erzählen lassen.





















 Könnte es sein, »ARD-Deutschlandtrend«,
Könnte es sein, »ARD-Deutschlandtrend«,