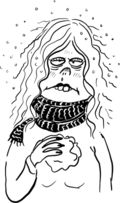Inhalt der Printausgabe
Mai 2006
|
Humorkritik spezial »Not all drugs are good. Some of them are great!« (Seite 3 von 3) |
||
Zum Touren ist er gezwungen, denn trotz des Erfolgs ist Hicks oft pleite: Er gibt seine Gage regelmäßig für Drogen und Alkohol aus. Die scheinheilige Politik, Marihuana und horizonterweiternde psychedelische Drogen zu verbieten, aggressiv machenden Alkohol und giftiges Nikotin aber zu erlauben, wird zu einem zentralen Thema seiner Bühnenmonologe. »Warum ist Marihuana verboten? Es wächst doch überall auf der Welt! Wie kann die Natur gegen Gesetze verstoßen? Ist es nicht ein bißchen paranoid, die Natur zu kriminalisieren? Marihuana zu verbieten ist wie Gott vorzuwerfen, er hätte einen Fehler gemacht. ›Hey‹, sagt Gott, nachdem er die Welt erschaffen hat, ›ich hab’ überall Dope rumliegen lassen… Hätte ich bloß diesen Joint am dritten Tag nicht geraucht! Das war der Tag, an dem ich die Opossums erschaffen habe! Nun werden die Menschen denken, sie sollen davon Gebrauch machen! Shit, jetzt muß ich die Republikaner erfinden!‹ Und Gott weinte.« Am Neujahrsmorgen 1988 wacht Hicks alleine auf. Seine Freundin Pamela ist nicht da, und er erinnert sich nur vage an den Abend: eine Party, viel Alkohol, Aggression und ein handfester Streit mit Pamela auf dem Balkon, die Drohung, sie übers Geländer zu stoßen, aus dem 22. Stock. Daß sie nicht da ist, kann nur zwei Gründe haben: Sie hat ihn verlassen – oder sie liegt auf der Straße. In Panik ruft er bei ihr an. Sie hebt ab. In diesem Moment beschließt Hicks, sein Leben zu ändern, und besucht ab sofort Treffen der Anonymen Alkoholiker. 26 Jahre alt ist er nun. Mit der Abstinenz kehrt der Erfolg zurück. Hicks schließt seinen ersten Plattenvertrag bei einem Indie-Label, seine CDs werden eher wie Rock- denn Comedyplatten beworben. Es folgen die erste Aufzeichnung einer Show, »Sane Man«, etliche Gastspiele bei Letterman und ein Special beim Bezahlfernsehen HBO. Zum landesweit gefeierten Star aber wird Hicks nur in England. Dem britischen Enthusiasmus für den amerikakritischen Südstaatler ist auch die Aufnahme seines Montreal-Sets »Relentless« zu verdanken: Ein Scout der britischen Fernsehgesellschaft Tiger Television ist von seinen Auftritten beim Comedy Festival so begeistert, daß sie zusätzlich zu den sechs halbstündigen Features, die sie vertraglich mit den Organisatoren in Montreal vereinbart hat, Hicks’ gesamte Show aufzeichnet. Channel 4 entschließt sich, daraus eine einstündige Sendung zu machen, zusätzlich zur regulären Berichterstattung über das Festival, das in England alljährlich gespannt verfolgt wird. Zu diesem Zeitpunkt hat Hicks seine kaustische Show annähernd perfektioniert. Er setzt spielerisch Bestandteile früherer Sets zu einem fesselnden Stream of Consciousness zusammen, und mehr denn je wird sein Comedy Set zum Rock’n’Roll-Konzert, sein Mikro zum Instrument. Er schreit, tobt, springt über die Bühne, simuliert Verkehr mit seinem einzigen Requisit, einem Barhocker, und schiebt sich das Mikrophon – »Ouuuaarrgghh!!« – in den Rachen, um onomatopoetisch darzustellen, was Rockstars tun, die sich für Werbung hergeben oder für die Antidrogenkampagne der Regierung Bush: They’re sucking satan’s cock. Ein Stück, das er auch einmal überraschend vor Managern der Plattenindustrie bringt, die ihn als ersten Comedian zur alljährlichen Firmenparty eingeladen haben. Im Juni 1993, ein halbes Jahr nachdem das Rolling Stone Magazine ihn zum »Hot Comic 1993« gewählt hat, läßt Hicks die Ursache für die Leibschmerzen untersuchen, mit denen er sich schon längere Zeit herumschlägt. Er ist nicht krankenversichert und deshalb nie zum Arzt gegangen. Es ist Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Ärzte geben ihm ein halbes Jahr. Sein letzter, zwölfter Auftritt bei Letterman wird wenig später unter nicht ganz geklärten Umständen aus der Show geschnitten. Hicks macht Scherze über die Abtreibungsgegner von Pro Life, und in Teilen des Ausstrahlungsgebiets von NBC hat Pro Life Werbespots geschaltet. Später macht Lettermans Produktionsfirma den Sender verantwortlich, der aber behauptet, keine Änderungen an der Show vorgenommen zu haben. Hicks ist zutiefst verletzt, er sieht sich ein weiteres Mal mundtot gemacht und weiß: Es wird das letzte Mal in seinem Leben gewesen sein. Dieser Vorfall wird zum einzigen Gegenstand seiner letzten Auftritte. Trotz seiner Schmerzen, gegen die er kein Mittel nehmen will, arbeitet er wie ein Besessener, plant eine Fernsehserie in Großbritannien und tritt weiterhin auf. Seine Sets werden immer düsterer. Am 5. Januar 1994 gibt Hicks seine letzte Vorstellung, zwei Wochen vor seinem Tod hört er für immer auf zu sprechen. Möglicherweise ist es eine Art »Prinzessin- Diana-Syndrom«, das Hicks posthum überlebensgroß werden ließ. Doch auch ohne sind mir Hicks’ schmerzhafte, bisweilen zynische Aufrichtigkeit und sein großes komisches Talent ein leckeres Gegengift zu der seichtdummen Unterhaltung, die dank Staats- und Kapitalfernsehen heute ubiquitär ist. Insbesondere seit den Anschlägen vom 11. September sind drastische Töne wie die von Hicks selten. Sieht man heute »Relentless«, stellt sich ein Déjà vu-Erlebnis spätestens ein, wenn Hicks auf George Bush und den Golfkrieg zu sprechen kommt. Mit Sicherheit verehrt die kleine, aber eingeschworene Hicksgemeinde ihren Hausgott genau aus diesem Grunde heute mehr denn je. Oliver Nagel »Relentless« von Bill Hicks gibt es diesen Monat als Aboprämie! HIER klicken! |
||
|
|










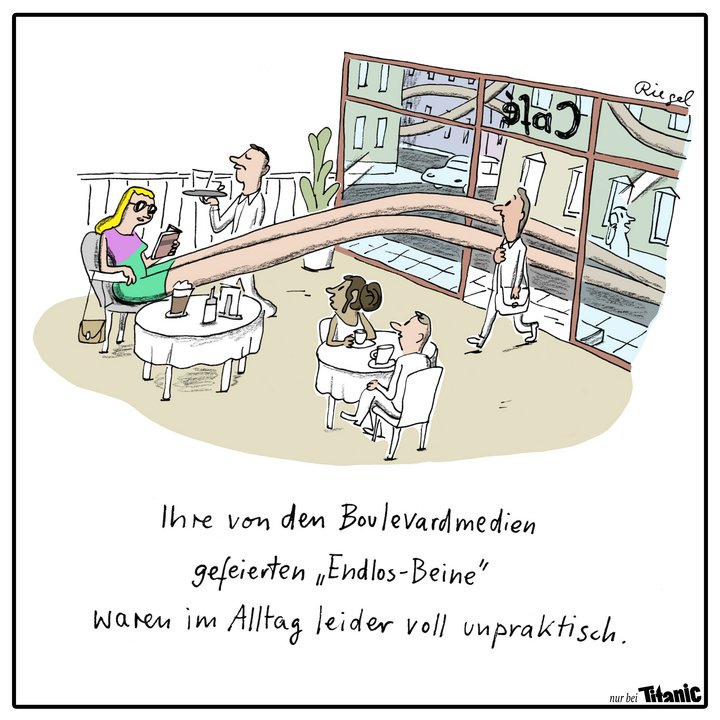












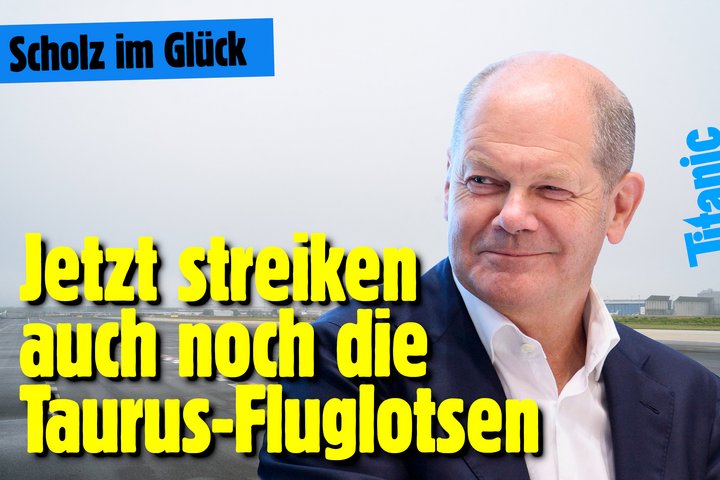


 Kurze Anmerkung, Benedikt Becker (»Stern«)!
Kurze Anmerkung, Benedikt Becker (»Stern«)!