Inhalt der Printausgabe
Dimpel, Stiesel, Piesepampel

von Ella Carina Werner
Gerne spaziere ich durch die Stadt, betrachte die Menschen und ordne sie in Gesellschaftstypen ein. Das geht, dafür habe ich die Broschüre eines führenden Sozialforschungsinstitutes mit den fundamentalen zehn Typen zur Hand.
Da, kurz hinter dem Hamburger Hauptbahnhof, ein astreiner Traditionalist! Traditionelle Kurzhaarfrisur, traditionelle Wachsjacke, traditionelle Fußbekleidung (Schuhe). Die Jetztzeit gefällt ihm nicht, die Zukunft ist ihm verhasst. Missmutig stapft er durch die grellbunte Gegenwart wie Carl Spitzweg durch das Museum of Modern Art, auf der Suche nach einem rettenden Lotto-Toto-Laden, einem Hertie oder einem berittenen Gendarmen. Unauffällig hefte ich mich ihm an die Fersen, damit er mich nicht sieht. Das ist ein Leichtes: Traditionalisten sehen durch Tech-Progressive wie mich grundsätzlich hindurch.
Der Graukopf geht am Asian-Fusion-Restaurant vorbei, würdigt die Tapas-Bar keines Blickes, nickt dem bankrotten Nähmaschinenladen gedankenschwer zu und betritt ein Wirtshaus mit dem Namen »Frau Müller«, es könnte aber auch »Anno Dazuma(h)l« oder »Super! Hier gibt es kein WLAN« heißen. Interieur: schweres Eichenholz, von der Decke baumeln rostige Bratpfannen. In der Luft liegen Risikounlust, Passivität und der Geruch von Blutklößen. Drei, vier Leute sind unter den Schlemmergästen, die mehr ins neo-ökologische Milieu hinüberlappen, aber gehen in der Masse unter.
Von einem der Tische erhebt sich eine Frau, winkt meinen Traditionalisten zärtlich herbei. Bluse, Bernsteinkette, Bernsteinaugen: auch sie eine Bilderbuch-Traditionalistin. Interessanter wäre es, wenn sie ganz anders drauf wäre, etwa eine Angehörige der fortschrittsoptimistischen Leistungselite. Jede gemeinsame Urlaubsreise, jedes Gespräch bärgen sozialen Sprengstoff. Jede Nacht ein endloses Für und Wider zu den Reizthemen Mars-Exkursionen und Menstruationstassen und darüber, welche Unternehmung fürs Wochenende ansteht: Innovation Lab oder Delfinshow? Horizonterweiterung nonstop, Verbalgerangel bis zum Morgengrauen, ehe man sich am Ende geil im Bett versöhnt, wobei die Frage aufkommt, ob die Fußfesseln jetzt aus Polypropylen oder Jute … Herrlich! Langeweile käme da nicht auf.
Aber nein, schon sieht man die beiden Traditionalisten einträchtig mampfen und über irgendetwas wettern, vermutlich über LED-Lampen und diesen durchgeknallten Käse namens Mozzarella, ehe sich ihre Gesichtszüge nach dem dritten Steckrübenschnaps plötzlich entspannen, die Augen zu leuchten beginnen. Hand in Hand träumen sie sich zurück, hinein in die goldenen Zwanziger, d.h. die 1620er, hinein in den Dreißigjährigen Krieg.

Leben auf der Überholspur: Performerinnen um 1900.
Natürlich sind nicht alle Traditionalisten über einen Knochenkamm zu scheren. Es gibt rangniedrige und ranghohe Traditionalisten, gestrige und vorgestrige Traditionalisten, Klöße liebende und Klöße hassende Traditionalisten, Spitzkohlverfechter und -verächter, die sich seit Jahrzehnten in Traditionalisten-Foren, d.h. auf der Straße, verbal bekriegen, und ab und an auch körperlich, mithilfe von sehr großen Steinen, unter Traditionalisten ist das erlaubt. Sicher aber ist: Sie sind die einzige Gruppe, die seit Jahrhunderten in den Milieu-Modellen der Sozialforscher auftaucht. Traditionalisten wird es immer geben und gab es schon immer, zum Beispiel im Zeitalter der Industrialisierung, als sie sich gegen Frauenhosen auflehnten und gegen Industrialisierung, was ein wackeres, bewundernswertes Unternehmen war.
Und doch: Solange sie keine Fackelzüge oder Demos pro Lebensschutz veranstalten und mir meine schöne Menstruationstasse lassen, sind mir Traditionalisten im Großen und Ganzen recht sympathisch. Sympathischer jedenfalls als die satten zwölf Prozent an Pragmatikern mit ihrer perversen Anpassungs- und Leistungsbereitschaft und ihrem ausgeprägten Nützlichkeitsdenken. Von allen unliebsamen Gesellschaftstypen sind mir Pragmatiker die unliebsamsten, mit ihren Pragmatikercafés (klar: Selbstbedienung) und Pragmatikermucken (Medleys), mit ihren zahllosen Post-its und Hunden. Aber nur pragmatische Hunde, die man problemlos kämmen und einschläfern kann. Mit ihren 3-in-1-Jacken, Hello-Fresh-Boxen und All-Age-Filmen. So wie diese himmelschreiende Mittvierzigerin dort drüben auf der Straße, die ich durchs Fenster des Wirtshauses erspähe, in der Hand eine One-Pot-Pasta in der Pappschale, die sie im Laufschritt hinunterschlingt, dass die schlammbraune Soße spritzt, und zugleich am Telefon irgendetwas organisiert, wahrscheinlich ihr Begräbnis. Ein Depp, wer dies nicht zeitig plant! Einziger Daseinszweck von Pragmatikern ist es, die Dinge zu Ende zu bringen, immer und immer wieder. Dabei grinsen sie scheiße, sind scheiße angezogen, aber nie scheiße gelaunt, das ist wichtig! Pragmatiker empören sich über gar nichts, weil das unnötig Energie kostet, Energie, die anderweitig eingesetzt werden kann, wenn sie die zehnte Rigipswand ins Haus einziehen oder in ihr Herz. Natürlich sind sie tolerant bis zum Erbrechen. Alles finden sie okay. Andersdenkende: okay. Blutklöße: okay. Delfinshows: okay. Außer unvollendete Musik. Darüber können sich Pragmatiker richtig aufregen. Beethovens »Unvollendete«, ein halbgares Fragment, weil der inkonsequente Idiot auf halber Strecke verstarb! Beethoven, der schicksalsgebeutelte Titan, der nach heutigen Begrifflichkeiten ein chaotischer Liberal-Intellektueller war, der seine Unterhosen auf dem Klavier getrocknet haben soll, von seinen Zeitgenossen aber als komischer Heini etikettiert wurde.
Aufgepasst: Bei den bisher genannten Milieu-Typen handelt es sich um spezifisch deutsche. Für die Schweiz hat selbiges Forschungsinstitut zusätzlich noch den Eskapisten im Angebot, und wer je in der Schweiz war, kennt sie von außen und innen: Aberhunderte Eskapisten-Bistros mit Eskapistenspeisen (Toast Hawaii), an den Wänden die herrlichsten Landschaftstapeten (Timmendorfer Strand). Überhaupt ist die ganze Milieu-Kiste, global gesehen, unerhört komplex und je nach Landstrich verschieden.
Man stelle sich nur einmal vor: Eine junge aufstrebende Hedonistin in einem Kaff namens Oimjakon in der ostsibirischen Tundra, dem kältesten Dorf der Welt. Worst Case! Die 19jährige Jekaterina, Kosename Katjuscha – witzig, clever, spaßorientiert. In der Tasche: ein Einser-Abi und die CD »Ibiza Party Sounds Vol. 3«. Eigentlich würde sie jetzt gern ein paar Jahre, Jahrzehnte entspannt feiern, Fitzgerald lesen, Stuckrad-Barre wegschmökern, Schöfferhofer Weizen-Mix Grapefruit trinken, S-Bahnsurfen, illegale Raves aufsuchen und bei der ein oder anderen Karaoke-Fete mitgrölen – aber wie denn, wenn der Speichel auf den Lippen sogar in Innenräumen binnen weniger Sekunden zu winzigen Eisnadeln gefriert?! Statt Partyfood gibt es Weißfisch, Weißfisch, Weißfisch bis zum Abkotzen und dann und wann ein Stückchen rohe Pferdeleber. Freizeitbeschäftigung: Schneebälle statt Runden schmeißen. Zum Heulen! Aber immer noch besser, als als Hedonistin in Sowjetzeiten geboren und mit hoher Wahrscheinlichkeit als »bedauernswerte Individualistin« oder »gehirnkranke Arschgeige« eingeordnet worden zu sein.

Angst vor neuen Horizonten? Seventies-Traditionalist.
Überhaupt ist von allen gängigen Sozialtypen der Hedonist der brüchigste und fragilste. So fragil, dass er hierzulande auf der sozialen Leiter binnen weniger Jahre nach unten gerutscht ist. Gestern noch auf Yuppie-Partys in Lofts geladen, heute in den feuchten, stroboskop-durchzuckten Partykellern des Prekariats – shit happens! Lebenslustige Menschen mit höherem Einkommen sind in aktuellen Milieu-Modellen hingegen in Performer und Expeditive unterteilt, welche protzige Statussymbole rigoros ablehnen – außer Mountainbikes, Jura-Kaffeevollautomaten und japanische Küchenmesser.
Kann man alle Menschen auf diese Art klassifizieren? Man kann! Wenn die Modelle nicht mehr reichen, darf man die Milieus nach eigenem Gusto weiter ausdifferenzieren. Weiter, immer weiter, um der galoppierenden Individualisierung der Gesellschaft Rechnung zu tragen. Man muss nur zwanzig Minuten durch eine belebte Fußgängerzone laufen. Wohin man schaut: Klimasensible Postmaterialistinnen, herumglotzende Nihilisten, bagelfressende Pantheistinnen und hier und da ein anzugtragender Onanist, den erkennt man am federnden Gang.
Übrigens kann ich jederzeit abschalten und die Menschen da draußen in ihrer je einzigartigen Individualität wahrnehmen, als blutvolle, mehrdimensionale Charaktere wertschätzen, z.B. Olaf Scholz, und auf jedwede Kategorisierungen und Etiketten pfeifen. Sozialforscher können das nicht. Ob beim Stadion-Rock oder morgens um sechs in der U-Bahn, stets sind sie zum Klassifizieren verdammt, und noch in ihren düstersten Träumen, wenn eine Armada an Zombies nachts an der Haustür rüttelt, werden die Untoten fein säuberlich in traditionelle und progressive unterteilt, bis der Schädel brummt – so wie dieser junge Komponist mit absolutem Gehör, den ich einmal in Hamburg traf, der die Tonhöhe jedes Mückengesumms noch im Dämmerschlaf bestimmen muss. Da kommt man nie mehr heraus.
Letztlich ist es mit den Sozialmodellen natürlich alles eine Sache der eigenen Sichtweise. Ein Geistesmensch wie Jürgen Habermas mag die Menschen still und heimlich einteilen in Gescheite, Halbgescheite, Dumpfbacken, Schwachmaten, hohle Nüsse, Dimpel, Stiesel, Piesepampel und Jürgen Habermas. Und wer will es ihm verdenken?


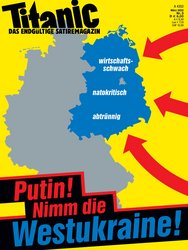
 Feb 2022
Feb 2022

















 Gemischte Gefühle, Tiefkühlkosthersteller »Biopolar«,
Gemischte Gefühle, Tiefkühlkosthersteller »Biopolar«,





