Artikel
Invasion aus dem Stall
Während die menschliche Zivilisation gehend vor die Hunde schleicht, klettern Waschbären munter die Leiter der Evolution herauf. Während Wissenschaftler sich noch Erklärungen ausdenken, überholen uns die putzigen Bärchen mit links.
Es war der hiesigen Presse in den vergangenen Wochen nur eine Randmeldung wert: Waschbären, so steht es in einem Bericht der Bundesregierung, stellen eine Bedrohung für die Artenvielfalt in Deutschland dar, besonders Sumpfschildkröte und Gelbbauchunke seien von dem Neozoen bedroht. Für die Schildkröte ist das blöde, und den Unken wird schon mal gewunken. Ihr Widersacher jedoch erlebt die Blütezeit seiner Durchbeiß- und scheißgeschichte in Deutschland, die mit dem von Reichswaschbär Hermann Göring gebilligten Aussetzen der landesfremden Pelzwuschel ihren Anfang nahm – Nationalsozialismus einmal anders. Doch handelt es sich bei dem Aussterben einheimischer Arten durch den Amibär wirklich um einen ökologischen Unfall oder folgt das Verhalten des Waschbären einem Muster, steckt dahinter gar eine Absicht? Hunger kann, muss aber nicht die einzige Jagdtriebfeder sein. Schildkröten beispielsweise werden oft nicht getötet, sondern weisen nur schwere Verletzungen auf, als habe ihr Angreifer sie peinigen wollen. Seit wann verfolgt der Watschbär diese Taktik? Gibt es frühere Anzeichen für gezieltes Spezies-Bullying? In der Tat: 2017 meldete „Spiegel online“: „Schon lange leben Waschbären in Deutschland, obwohl die Art eigentlich eingewandert ist. Doch die Tiere breiten sich rasant aus – und gefährden immer mehr seltene Vögel.“ Einige Jahre zuvor, 2010, hieß es hingegen noch lapidar bei Welt.de: „Der Waschbär kann der sehr seltenen und im Lebensraum anspruchsvollen Wildkatze in die Quere kommen.“ Als Eierräuber wird lediglich der Marderhund benannt, während der Waschbär sich ungeschoren ausbreiten konnte. Inzwischen ist er, so scheint es, aus der Deckung gekommen und pflastert seinen Watschelpfad mit Artenleichen. Nach den Vögeln sollen nun auch die Amphibien der Gebietssucht des kleinen Rackers weichen.
Die Angewohnheit, Tiere just zum Zeitvertreib auszurotten, kennen wir sonst nur vom (nach Wölfen) gefährlichsten Raubtier des Planeten: dem Menschen. Werden wir gerade Zeuge einer analogen Entwicklung des Waschbären zu einem superintelligenten Umweltzerstörer? Fakt ist: Der Waschbär macht immer wieder mit Eigentümlichkeiten von sich reden, die sonst vom Menschen bekannt sind. Rücksichtslose Ausrottung anderer Spezies ist dabei nur die augenfälligste Gemeinsamkeit. So scheint es im Geist der Waschbären bereits so etwas wie ein primitives Selbst- und Schuldbewusstsein zu geben. Wie in unserer menschlichen Gesellschaft gleichen einige besonders naturverbundene Exemplare die zerstörerische Lebensweise ihrer Artgenossen aus, indem sie nachts Abfalltonnen nach Verwertbarem durchwühlen, „containern“, wie es im Szenejargon heißt. Selbst verdorbene Speisen werden dabei per Pfotencheck als „echt noch gut“ oder wenigstens „total ok“ bewertet und qua Verzehr „gerettet“. Hygienehandlungen sind den pelzigen Gesellen indes, auch hier uns gleich, ein fast zwanghaftes Bedürfnis – sie waschen nämlich (daher auch der Name) alle Nahrung vor dem Essen sehr behände und nachlässig, und werden deshalb ständig krank.

Leider kein seltener Anblick mehr: Minderjähriger Täter beim Containern ("Raccoontainering")
Diese Ähnlichkeiten sind freilich alle keine Beweise für eine rasante Evolution des Waschbären zu einer intelligenten Herrenbärenart, auch bei größter äußerer Übereinstimmung mit uns Menschen heißt es genau hinschauen. Von den 100 Naturgesetzen sprechen immerhin 99 gegen eine solche High-Speed-Optimierung. Und doch ist da dieses eine Naturgesetzschlupfwurmloch, das diese einzigartige Entwicklung zulassen würde. Dem Anschein nach haben uns die munteren Gesellen mit dem lustigen Kassengestell im Gesicht in wichtigen Bereichen der gesellschaftlichen und technischen Entwicklung bald eingeholt. Die flexiblen Arbeitszeiten in der Waschbärwäscherei sprechen ebenso dafür wie der differenzierte Umgang mit Geruchssignalen. „Urin, Kot und Drüsensekrete, die zumeist mit der Analdrüse verteilt werden, kommen dabei als Duftmarken zum Einsatz.“ Unter Menschen nehmen olfaktorische Botschaften dieser Art immerhin eine Schlüsselfunktion in der zwischenmenschlichen Kommunikation ein – erfolgreiche Meetings beruhen nicht selten auf einer intensiven persönlich durchströmten Atmosphäre, der jeder geruchssensible Mensch schnellstmöglich entfliehen möchte. Nicht zuletzt konnten Forscher eine schier unglaubliche Veränderung am Bärenkörper beschreiben. In einer Studie aus dem Jahr 2010 heißt es: „Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, dass in jüngerer Vergangenheit im südlichen Nordamerika (Oklahoma & Texas) einige vollständig haarlose Waschbären dokumentiert wurden. Räudemilben konnten in diesen Fällen als Ursache ausgeschlossen werden. Um was es sich letztendlich bei diesem Phänomen handelt, konnte noch nicht endgültig geklärt werden.“ Der Gedanke drängt sich auf, die Tiere legten ihr Fell ab, um modisch größeren Spielraum zu gewinnen, doch sind vorschnelle Schlüsse hier fehl am Platz. Gewiss, es wurden in einigen Habitaten primitive Jeans mit zahlreichen Löchern an den Beinen aufgesammelt, auch waschbärkopfgroße Pelzmützen aus Wildkatzenfell sind angeblich bereits gefunden worden. Feuerstellen, an denen Waschbären wilde Kriegstänze aufführen und etwas rufen wie: „Menschen, Menschen, seid die näkschten“, wollen Wanderer schon mehrmals gesehen haben. Hier besteht Klärungsbedarf.

Noch handelt es sich um bloße Spekulation, doch sollten die Vermutungen sich bestätigen, gäbe es handfeste Beweise für den Griff zur Weltenkrone von kleinen, feuchten Waschbärpfoten. Bislang gibt es lediglich Indizien, diese lassen sich jedoch schwer von der Hand weisen. Und Beruhen Indizien am Ende nicht auf Fakten, sind Fakten nichts anderes als die Bausteine von Beweisen, und Beweise die Wahrheit? Die Vernichtung der Menschheit durch die Waschbären – sie könnte Hitlers späte Rache sein.
Valentin Witt














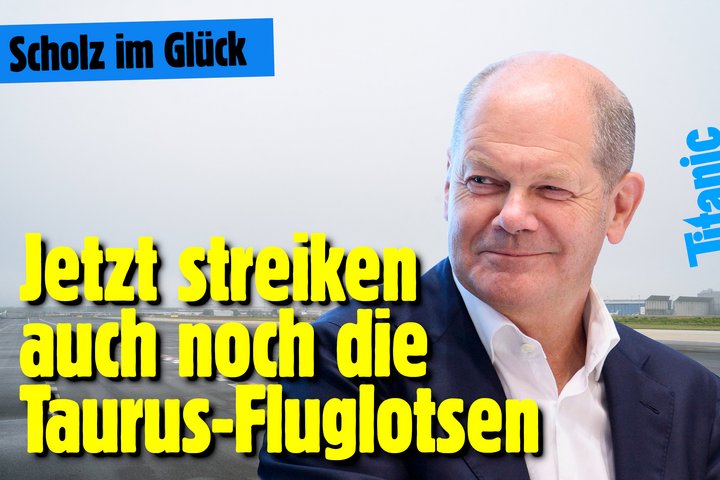

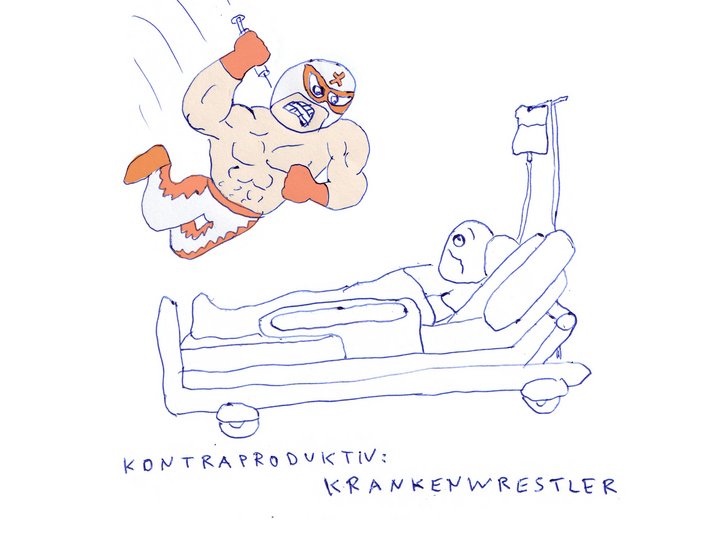


 Wie bitte, Extremismusforscher Matthias Quent?
Wie bitte, Extremismusforscher Matthias Quent?



