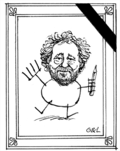Gärtners kritisches Sonntagsfrühstück: Zurück in die Zukunft
 Natürlich war früher nicht alles besser, es war sogar vieles schlechter; aber eben nicht alles, und was wirklich besser war, war, daß es besser werden konnte: Stichwort Zukunft, die es nach einem Gedanken des britischen Essayisten Mark Fisher im siegreichen Kapitalismus nicht mehr gibt. Denn Kapitalismus ist Kapitalismus ist Kapitalismus, und Zukunft unterm Kapitalismus ist, daß es Flugtaxis geben wird und daß die einen die Taxis chauffieren und die anderen sich chauffieren lassen und die allermeisten sich kein Taxi werden leisten können, weder am Boden noch in der Luft.
Natürlich war früher nicht alles besser, es war sogar vieles schlechter; aber eben nicht alles, und was wirklich besser war, war, daß es besser werden konnte: Stichwort Zukunft, die es nach einem Gedanken des britischen Essayisten Mark Fisher im siegreichen Kapitalismus nicht mehr gibt. Denn Kapitalismus ist Kapitalismus ist Kapitalismus, und Zukunft unterm Kapitalismus ist, daß es Flugtaxis geben wird und daß die einen die Taxis chauffieren und die anderen sich chauffieren lassen und die allermeisten sich kein Taxi werden leisten können, weder am Boden noch in der Luft.
Im Morgenblatt schreibt der Architekturredakteur über das Münchner Arabellahaus, einen Appartementkomplex im Nordosten der Stadt, der ab dem Ende der sechziger Jahre bereits das leistete, was Bauen heute wieder soll: Verdichtung, die „Nachbarschaft von Wohnen und Arbeiten, Gastronomie und Versorgung“, die „Stadt in der Stadt“, statt daß man vor ihren Toren ständig neue Flächen versiegelt, damit Tausende Tag für Tag ins Zentrum juckeln müssen und abends im Nichts sitzen. Eine Wohnmaschine, aber im guten Sinne, die jetzt in die Jahre gekommen ist, und darum geht es, aber nicht hier.
Hier geht es um die Ästhetik, die „die der sechziger Jahre“ ist. „Heute baut man Schießschartenhäuser. Vertikales. Früher waren liegende Formate und eine horizontale Fassadengliederung en vogue. Der Horizont war etwas, worauf man gern schaute, denn er versprach die Zukunft“, und Bauten wie das Arabellahaus schürten „heitere Moderne-Erwartungen an eine neue, bessere und auch aufregendere, ja freiere Zeit“, während man nicht wissen will, welche Erwartungen die Berliner BND-Zentrale schürt. Ich möchte meinen: gegenteilige.
In Frankfurt am Main haben sie die alte Oberfinanzdirektion an der Adickesallee ja abgerissen (und, wie passend, irgendeine „Frankfurt School of Finance and Management“ hingestellt), mit dem alten Kanzlerbungalow in Bonn werden sie’s nicht wagen; so daß, wo allerorten (in Frankfurt zumal) die Nachkriegsmoderne abgeräumt wird – was sowohl den leidigen Krieg als auch die nicht mehr benötigte Moderne aus der Welt schafft –, man immerhin da wird sehen können, was das mal war: Horizont, Zukunft, und was an seine Stelle getreten ist: die Schießscharte, der Bunker.
Zeuge: „Ach, in was für einer Zeit leben wir bloß.“ Köster: „In einer fortschrittlichen, Herr Bettler, deswegen schreiten die Dinge ja so fort.“ ZDF, 1980
Daß Autos heute Panzern gleichen (und neue große Audis ihr Blinkzeichen als Ellbogen ausfahren), Familien in synthetischer Uniformiertheit durch die Wochenenden stiefeln und „massiv“ eine so populäre Journalvokabel ist, fügt sich da leider recht paßgenau ein, und auch wenn man die Regression in Retrofreuden nicht übersehen soll, ist eine Stunde mit einem deutschen Fernsehkrimi aus den siebziger oder achtziger Jahren eine ästhetische Wohltat, und nicht allein, weil hin und wieder ein Regisseur Fassbinder gesehen hat, die Einstellungen ewig dauern, niemand gefoltert wird (außer evtl. durch überlange Einstellungen) und der Abspann alle Mitwirkenden in respektvoller Ausführlichkeit aufzählt (das ist vorbei, seit es eine private Konkurrenz gibt, zu der auf keinen Fall umgeschaltet werden darf). Nein: Diese Dezenz und Zivilität (und sei's aus schlechtem Gewissen). Diese Theatersätze im Präteritum. Die Herren in Anzug und Mantel (Patriarchat, okay), Autos, halb so schwer wie heute, mit freundlichen Gesichtern und niedrigen Fensterlinien. Das Böse ist hier noch die Ausnahme und verdankt sich allgemeinen Defekten wie Hab- oder Eifersucht, und die Herren Kriminaler sind noch keine einsamen Psychowracks mit „eigener Geschichte“, sondern freundliche, aufmerksame Beamte, die die Sache im Griff haben. Daß sie, mindestens als Derrick oder der formidabel elegante „Alte“ Erwin Köster, gern im gehobenen Milieu aufklären, darf man natürlich erkennen.
Sozialdemokratie, als sie vielleicht schon falsch war, aber noch als Idee funktionierte. Schimanski hat den sich verhärtenden Verhältnissen dann den Stinkefinger zeigen müssen, und daß die vertikale TV-Moderne aus einer ganzen Kommissarsarmee besteht, erzählt bereits die ganze Geschichte.




















 Wussten wir’s doch, »Heute-Journal«!
Wussten wir’s doch, »Heute-Journal«!