Humorkritik | September 2018
September 2018
Tragisches ist ja deshalb herzzerreißend, weil uns die Komik genommen wird. Das Lachen wird uns aus dem Mund herausgestohlen.
Simon Stone
Nobody is perfect
Jemand muss Guido Knopp gesagt haben, dass es auch im posthitlerischen Zeitalter noch Frauen gibt. Auf den Gedanken könnte man kommen, hört man die Einleitung zur französischen Doku-Reihe »Despot Housewives – Die Frauen der Diktatoren«, hierzulande im ZDF zu sehen: »Sie stehen im Schatten und sind dennoch im Zentrum der Macht: die Frauen der Diktatoren und Autokraten. Manche sind Opfer; aber nicht selten sind sie auch die Drahtzieher. Als fürsorgliche First Ladies getarnt, engagieren sie sich für Frauen und Kinder. Doch ihre Spitznamen verraten ihr wahres Ich: ›Luzifer‹, ›Drachen‹, ›Lady Genocide‹ oder auch ›Lehrling des Faschismus‹. Wie viel Macht haben sie? Und welche Verantwortung tragen sie für die Taten ihrer Ehemänner?«
Der Ablauf ist in jeder Folge gleich: Zu vergnüglich-soapiger Musik wird der Lebenslauf des jeweiligen Genocide-Drachens gezeigt – Kennenlernen des Mannes im revolutionären Kampf (Jugendfotos, Weichzeichner!), Heirat, Machtergreifung, Machtausübung, Gewalt, Folter. Meine Lieblingsfolge ist jene mit dem Titel »Genossin Nummer Eins«: Faltig wie eine alte Diakonisse sitzt darin Frau Hodscha aus Albanien vor der Kamera und bezeichnet sich ironisch als »der Superkiller«: »Ich hatte entschieden, wer leben oder sterben sollte.« Nach der Diktatur wurde sie, um nicht für echte Verbrechen angeklagt zu werden, im sogenannten »Kaffeeurteil« wegen Bestellung von zu viel Kaffee auf Staatskosten zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt – und hatte Zeit zu räsonieren. Sie erwägt Altersmilde (»Vielleicht hätten wir mehr Nachsicht haben sollen«) und verwirft sie sogleich (»Aber die Häftlinge waren nicht im Gefängnis, weil sie unschuldig waren«), stutzt Frau Ceauc¸escu zurecht (»Angeberin«, »unglaublich oberflächlich«) und vergleicht Enver und sich mit anderen Paaren, zum Beispiel den Milos˘evic¸s (ganz andere Nummer, »die hatten ja Vernichtungslager«). Bald erscheint Frau Milos˘evic¸ auf dem Schirm und wird dabei gefilmt, wie sie im Fernsehen den Prozess gegen ihren Gatten anschaut: »Ihre Liebe gründet auf ihrem politischen Engagement«. Frau Gbagbo von der Elfenbeinküste wiederum ist gar »schlimmer als ihr Ehemann«, der nur an der Macht bleiben wollte, »weil seine Frau ihn dazu zwang«; dafür arbeitete sie laut ihrer Schwester immerhin fleißig »im sozialen Bereich, um so die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern«, und war so friedliebend, dass sie »nicht einmal ein Huhn töten« konnte. »Hitler konnte auch kein Huhn töten«, antwortet im Gegenschnitt der Menschenrechtsminister.
En passant erfährt man auch von liebenswerten Schrullen: Frau Pinochet etwa hört nachts ihren toten Mann an der Tür klappern; Frau Franco war eine »treue Anhängerin der Heiligen Theresa« und »trug immer eine Reliquie bei sich«, und Frau Marcos bezeichnet sich stolz als die »gierigste Frau der Welt«, besitzt einen »Baukomplex«, fünf Milliarden Dollar Privatvermögen aus der philippinischen Staatskasse und 3000 Paar Schuhe. »Die im Volk brauchen jemanden, den sie anhimmeln können«, weiß sie. »Und jemanden, der die Standards setzt. Masse folgt Klasse.« Man könne nicht übertreiben, »wenn es um Schönheit geht«. Wohl aber bei Hässlichkeit: »Das ist ein Verbrechen!«
Immer wieder wird hier der übliche sonore History-Kommentar vom Ressentiment ins Geifernde getrieben; die Serialität macht das Ganze noch bizarrer. Frau Arafat fungiert dabei als eine Art Meta-Frau, die in allen Folgen ein Gutteil der anderen Schicksale kommentieren darf (»Die Klugen gehen, wenn es Zeit ist zu gehen«), von ihr erfährt man auch über regelmäßige Treffen der Gattinnen untereinander. Spin-offs deuten sich an.
»In der Bibel steht: Niemand ist perfekt«, meint Frau Taylor aus Liberia. Es klingt versöhnlich.





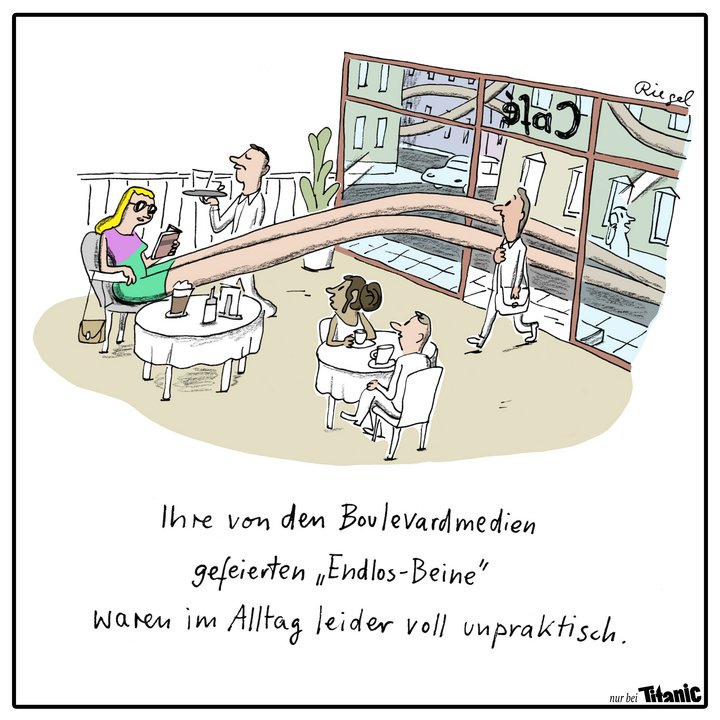












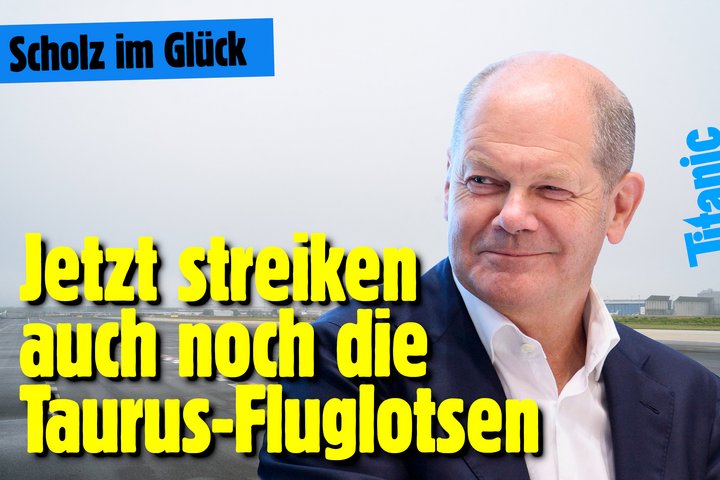


 Wussten wir’s doch, »Heute-Journal«!
Wussten wir’s doch, »Heute-Journal«!




