Humorkritik | Dezember 2018
Dezember 2018
Wir lachen, weil wir glauben, dass es ein Witz ist.
Fiston Mwanza Mujila, »Zu der Zeit der Königinmutter«
Polak / Böhmermann
Oliver Polak hat im Laufe seiner Bühnenkarriere immer wieder Judenwitze erzählt. Jan Böhmermann hat während einer Show, bei der auch Polak auftrat, nach dem Händedruck mit dem Juden Polak ein Desinfektionsmittel benutzt. Als wohlmeinender Mensch vermute ich, dass es beiden nicht darum ging, Antisemitismus zu befördern oder sich über die Opfer des Holocaust lustig zu machen, sondern Antisemitismus durch Verwitzelung erträglicher werden zu lassen. Dafür mag Polak besser geeignet sein als Böhmermann; aber eben auch nur, wenn man seine Bühnenfigur mit seinem »realen« Judentum gleichsetzt. Sein erster Programmtitel »Ich darf das, ich bin Jude« spielte mit ebendieser Frage: Darf der das? Darf er das, weil? Dürfte er es nicht, wenn? Es liegt auf der Hand, dass ein nichtjüdischer Zuschauer Polaks Bühnenwitze nicht einfach kontextlos hätte weitererzählen können, ohne für einen Antisemiten gehalten zu werden.
Nun ist der Comedian Polak aus seiner Rolle getreten und hat all den Antisemitismus, gespielt oder nicht, und die Judenwitzeleien, die er während seiner Auftritte und davor nicht nur mit Böhmermann erlebt hat, in aller Ernsthaftigkeit dokumentiert. Dass jemand, der seine Diskriminierung selbst komisch verarbeitet, am Ende nicht gereinigt und erlöst daraus hervortreten muss, sondern Erniedrigung und Beleidigung weiter mit sich schleppt, wurde hierorts bereits anhand des Beispieles Hannah Gadsby erörtert; dies trifft wohl noch stärker zu, wenn die Verarbeitung von anderen übernommen, fröhlich weitergetrieben und somit satirisch, also von der individuellen Erfahrung auf die Ebene gesellschaftlich-moralischer Verhandlung gehoben wird. Wie gut gemeint auch immer: Es ist die nie auflösbare Doppelrolle der Satire, dass sie in ihrer Imitation des Schrecklichen dieses Schreckliche einerseits bannen will, andererseits fortschreibt. Ein satirisch geäußertes Ressentiment kann aufklärend wirken – und zugleich dem Antisemiten Zucker geben.
Aus strikt satirischer Perspektive ist es übrigens egal, wer das Ressentiment vorbringt. Im Zweifel mag einem überzeugten Antisemiten der sich scheinbar antisemitisch äußernde Jude sogar lieber sein, weil dieser die Haltung des Antisemiten legitimiert. Dass Witze heute viel weniger danach beurteilt werden, wie gut und stimmig sie sind, als danach, wer sie reißt, zeigt, dass wir in Zeiten hart umkämpfter Identitäten leben. Wo sich aber auf Identität fixiertes Denken und satirische Ambivalenz ins Gehege kommen, wird es unübersichtlich.
Der Comedian Böhmermann hat sich ein Beispiel genommen am Comedian Polak und Judenwitze gemacht, ohne über dessen Lebensgeschichte und Lebenserfahrungen zu verfügen. Hätte er sie gebraucht? Genügt es nicht, dass er Satiriker ist? Künstler letztlich, der sich fremde Rollen und Welten aneignen darf, wie er will? Allzu leicht sollte er es sich nicht machen: Böhmermann, der Polak über dessen »Unique Selling Point« Judentum belehrt, mag sich für ideologiefrei halten – und ist doch nichts als zynisch: Vertreter einer unhinterfragten Marktlogik, in der jeder auf seine (diesfalls: komische) Identität und deren Verwertbarkeit abgeklopft wird. Polak hat allerdings Böhmermanns Spiel mitgespielt. Letztlich gehören sie beide derselben Welt an, auch wenn der eine, weil er keine Diskriminierung erfahren musste, ein bisschen weniger zum Nachdenken gezwungen ist.
















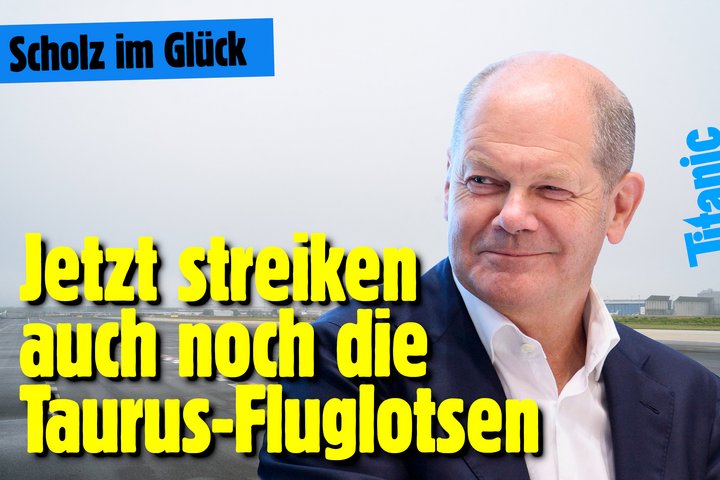

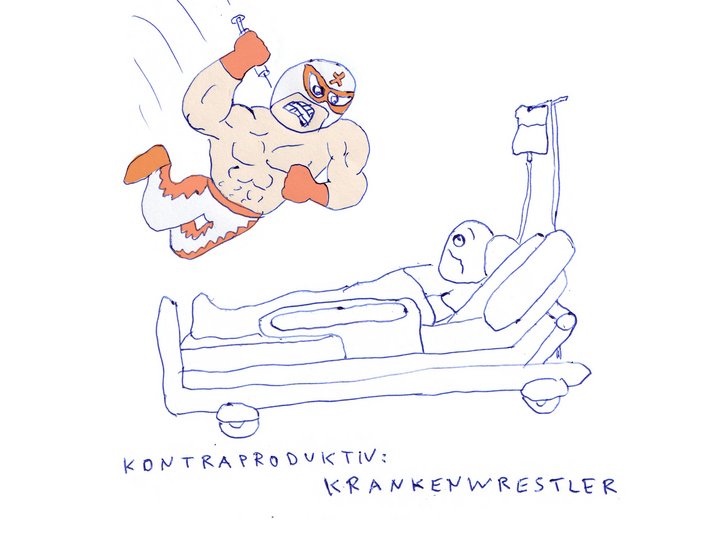


 Ciao, Luisa Neubauer!
Ciao, Luisa Neubauer!




