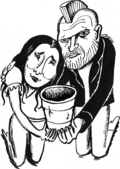Humorkritik | April 2012
April 2012
Komiker Kant
Daß Immanuel Kant Königsberg nie verlassen habe, ist nur eine Legende. Tatsächlich gelang es dem Philosophen hin und wieder, die Stadtgrenzen zu überschreiten, wenngleich seine weiteste Reise ihn gerade einmal auf das Gut Goldap des preußischen Generals von Lossow führte, wenige Meilen vor der russischen Grenze. Gelegentlich wagte er sich nach Moditten hinaus, eine Meile hinter Königsberg, um in den Semesterferien seinen Geist in der Gesellschaft des Oberförsters Wobser eine Woche ruhen zu lassen. Eine größere Reise plante Kant erst 1803, als er nur durch eine einschneidende Luftveränderung seine Blähungen loswerden zu können glaubte. Aber da war es, ein Jahr vor seinem Tod, schon zu spät, sein Körper machte nicht mehr mit.
Vermutlich nicht nur sein Körper. Auch sein Geist wollte nicht mehr in philosophische Höhen hinaufsteigen, sondern suchte festen Halt in Erdbodennähe: Nachdem Kant jahrzehntelang über Vernunft, Moral und Tugend aufgeklärt hatte, wollte er nun für den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unkenntnis in Sachen Erd-, Pflanzen-, Tier- und Völkerkunde sorgen. Das Ergebnis war die 1802 erschienene »Physische Geographie«, in der Kant all sein Weltwissen versammelte – ein Werk von erklecklicher Komik.
Denn der Königsberger Stubengelehrte weiß nicht nur Bescheid über die Tiere seiner Heimat, den Bären zum Beispiel: Der »ist ein großer Honigdieb, klettert auf die Bäume und wirft sich gleich einem zusammengeballten Klumpen herab.« Er kennt, ohne einen Fuß vor die Tür zu setzen, auch die Fauna der Tropen: »Das surinamische Hirschchen ist nicht einmal so groß wie ein Hase. Sein in Gold eingefaßtes Füßchen wird zum Tabakstopfen gebraucht.« Zu schweigen von der Meeresfauna, in der sich zum Beispiel »der Krak, das größeste Tier in der Welt« tummelt: »Wenn dieser heraufkommt, so nimmt er einen ungeheuren Umfang ein. Er soll große Zacken haben, die wie Bäume über ihn hervorragen.«
Die Flora des von Königsberg weit entfernten Erdballs bereitet Kant in seiner ostpreußischen Studierkammer genausowenig Schwierigkeiten. »Auf Hispaniola gibt es einen Baum, der giftige Äpfel trägt, dessen Schatten selbst gefährlich ist«, weiß er beispielsweise zu vermelden und der unbelebten Natur ebenfalls ihre Geheimnisse zu entlocken: »Das Meerwasser ist durchsichtig, welches von dem Salze herkommt.« Spaßig sind obendrein manche Gattungsnamen, wenn etwa die Quallen »Rotzfische« heißen und die Robben »Wassersäue«; und selbst wenn der gelernte Philosoph sich an sein altes Geschäft erinnert und eine Definition liefern zu müssen glaubt, klingt es komisch: »Der Wind ist dasjenige in Ansehung der Luft, was ein Strom in Ansehung des Meeres ist.«
Schön komisch ist auch, was Kant über die Völker der Welt weiß. Von keiner Erfahrung behindert, kann er einfache Merksätze formulieren: »Chile hat muntere und kühne Einwohner«, oder: »Die meisten orientalischen Nationen finden an großen Ohren ein besonderes Vergnügen.« Wie jeder schlechte Schütze trifft er manchmal ins Schwarze: »Die Mohren und andere Völker zwischen den Wendekreisen können gemeiniglich erstaunend laufen.« Meistens aber gibt er Fakten zum besten wie diese: Die Papuas, meldet Kant, »können die Augen nicht recht aufmachen«; die Hottentotten »sind sehr ehrlich und sehr keusch, auch gastfrei, aber ihre Unflätigkeit geht über alles. Man riecht sie schon von weitem«; und grausam, aber ordentlich halten es die »Anzikos«: »Bei ihnen soll nach dem Berichte der Missionarien Menschenfleisch von ordentlich dazu geschlachteten fetten Sklaven auf dem Markte feil sein.«
Fragt sich nur, wozu das Studium einer solchen »Physischen Geographie« gut sein soll. Kant weiß es: »Der Nutzen dieses Studiums ist sehr ausgedehnt. Es dient zur zweckmäßigen Anordnung unserer Erkenntnisse, zu unserem eigenen Vergnügen und gewährt reichen Stoff zu gesellschaftlichen Unterhaltungen.« Wo Kant recht hat, hat er jedenfalls nicht unrecht.





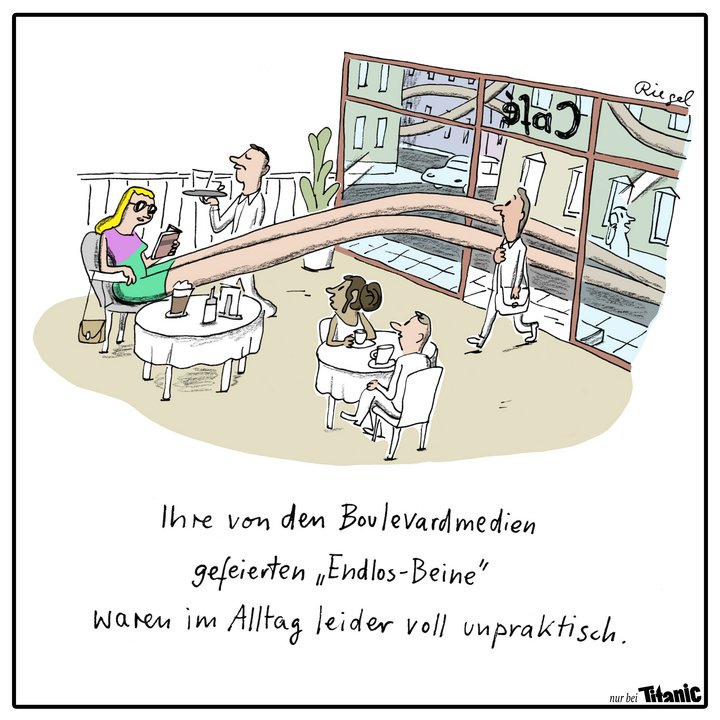












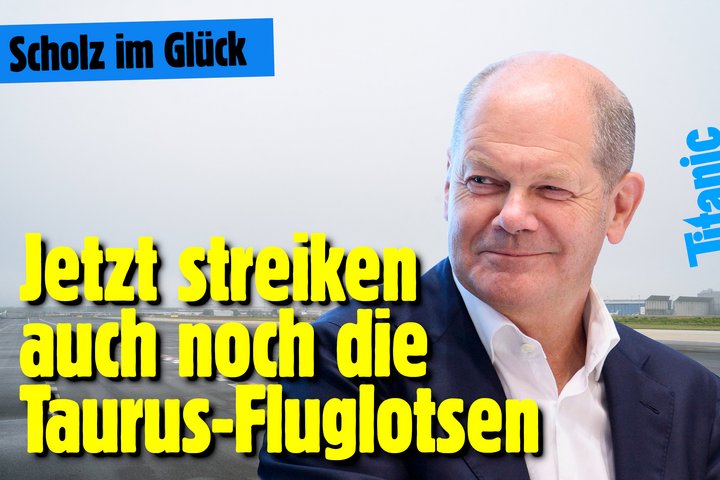


 Grunz, Pigcasso,
Grunz, Pigcasso,