Inhalt der Printausgabe
Juli 2006
|
Humorkritik (Seite 2 von 8) |
| Geiers Humorphilosophie |
|
Mit dem Phänomen, »daß theoretische Texte über das Lachen i.a. nicht zum Lachen sind« (H. Mentz), daß vielmehr »jede Erklärung des Komischen das Lachen darüber tötet« (Jacques Le Goff), habe ich mich bereits des öfteren beschäftigt und dabei, u.a. im Fall des zitierten Le Goff (TITANIC 8/04), die obige These bestätigen müssen, weshalb es mir ein um so größeres Vergnügen ist, nun einen Fall anzuzeigen, auf den das Gegenteil zutrifft: Manfred Geiers »Kleine Philosophie des Humors. Worüber kluge Menschen lachen« (Rowohlt) ist zwar nicht komisch im eigentlichen, dafür aber witzig im ursprünglichen Witz-Wort-»Sinne von Verstand, Klugheit, Wissen und Weisheit«. Meine Sympathie erwirbt sich Geier allein schon durch seine Beweisführung, daß kluge Menschen überhaupt lachen, denn – so Geiers Ausgangsthese – in der Philosophie galt Heiterkeit überwiegend als äbäh und wurde zugunsten einer auch in anderen, ach ja, eigentlich allen gesellschaftlichen Bereichen (Kirche, Erziehung, Politik, Feuilleton etc. pp.) dominierenden Diktatur des Bierernsthaften unterjocht, bei deren »Lachverbot« es – wie in Diktaturen üblich – letzten Endes um nix anderes als Macht ging und geht. Das war mal anders, sagt Geier, denn am Anfang der Philosophiegeschichte stand neben dem humorfreien Platon der »lachende« und deshalb von den Deutungshoheiten der Disziplin ignorierte oder diskriminierte Demokrit, dem Lachen als Ausdruck von »Seelenheiterkeit« und Versöhnung mit den Mißlichkeiten des Lebens diente. Von Demokrit ausgehend flaniert Geier durch die Chronik der Philosophie: über Aristoteles, der Witz als »kultivierten Übermut« definierte, und Diogenes, dessen Lachen das des kritischen Spötters war, das human-versöhnliche Lachen der Aufklärung (man staune: auch Kant lachte!) bis zu den Lach-Analysen Freuds (den ich allerdings nach wie vor nicht komisch finden kann, woran Geiers Beispiele von »Freuds Lieblingswitzen« nichts ändern – im Gegenteil). Im 20. Jahrhundert dann kein lachender Philosoph mehr, nirgends, allenfalls unfreiwillig komische wie freilich Heidegger; daß Geier am Ende Karl Valentin als »philosophischen Kopf« in den Zeugenstand zerrt, gehört zu den wenigen Urteilen des Buches, denen ich mich nicht anschließen mag, zumal Geier den unbegreiflichen Fehler macht, Valentin und sein Kunstfigur-Alter-Ego für identisch zu halten, und Unsinn schreibt wie »Gegen das Denken hat Valentin das Anschauen favorisiert« – ich dagegen denke, daß auch Valentin dachte. Auch dürfte es doch mittlerweile als unverzichtbar gelten, die Frankfurter Schule und dann natürlich auch die uns wohlvertraute Neue Frankfurter Schule in einer kleinen Philosophie des Humors zumindest zu erwähnen – weiß der Geier, worin des Autors Blindheit gründet. Verdienstvoll jedenfalls, daß und wie (nämlich unterhaltsam, erbaulich und anhand zahlreicher mehr oder minder komischer Exempel) Geier die Theorien bündelt, warum und worüber kluge Menschen lach(t)en und wie das funktioniert. Mit seiner These, daß gute Witze und guter Witz (s.o.) aus derselben klugen Quelle sprudeln und eben gerade kluge Menschen lachen und lachen machen, rennt er bei mir und meinen Lesern natürlich offene Türen ein, steckt doch hinter jeder TITANIC-Ausgabe mindestens ein kluger Kopf, der nicht unter meinem Niveau zu lachen pflegt. |
|
|



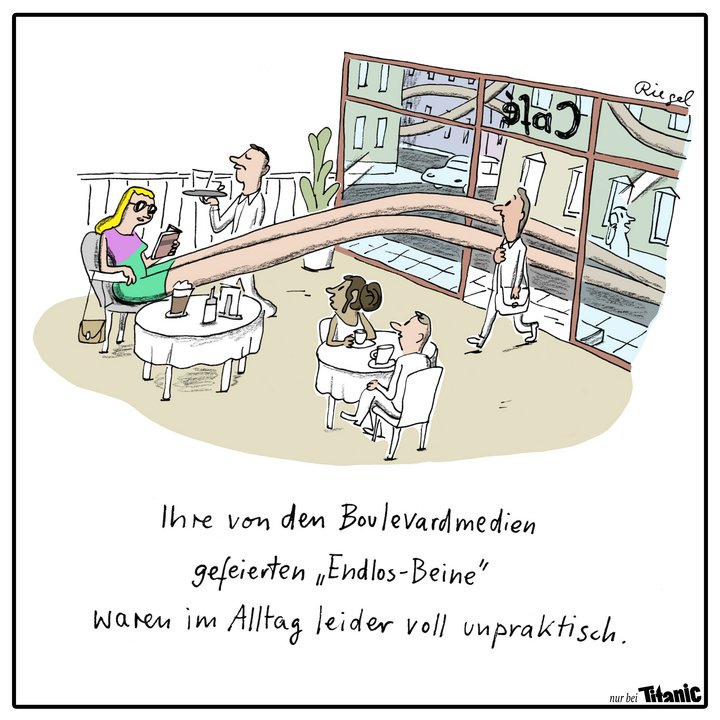












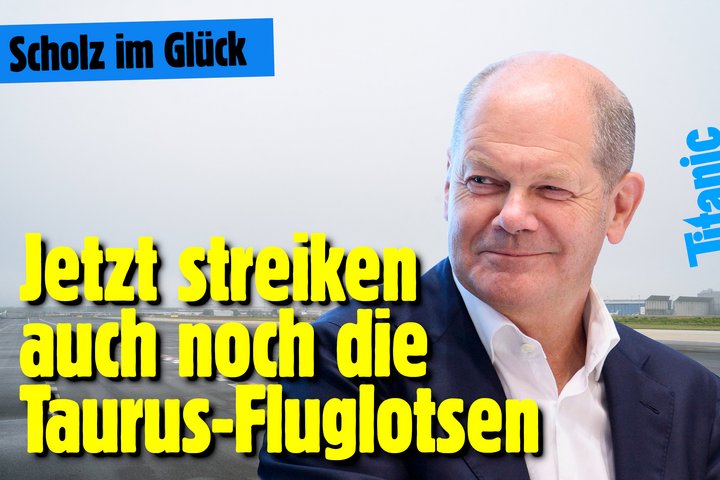


 Du, »Brigitte«,
Du, »Brigitte«,



