Inhalt der Printausgabe
Dezember 2001
Humorkritik
(Seite 5 von 6)
| Neues Altfränkisches |
|
"Altfränkisch" wird der Erzählstil Martin Mosebachs gerne von seinen Kritikern genannt, gemeint ist: umständlich und anachronistisch. Ein oberflächlicher Anwurf, der auch den "Nebelfürst" treffen wird, Mosebachs jüngst in der Eichbornschen Anderen Bibliothek erschienenen sechsten Roman. Doch wie bereits in Mosebachs früheren Werken geht es auch hier um mehr: nämlich um die vergnügliche und hochkompetente Widerlegung des postmodernen Axioms von der Unmöglichkeit zu erzählen und um eine fortwährende Diskussion von Wirklichkeit bzw. der Unmöglichkeit, diese zu erkennen - oder dem Unwillen dazu. Antiheld Theodor Lerner, Volontär im Berlin der Jahrhundertwende, lernt eben nicht, sondern fehlinterpretiert die Welt und setzt selbst falsche Zeichen: Zuerst geht er einer Hochstaplerin auf den Leim und anschließend auf Expedition, um die nördlich von Spitzbergen gelegene und bis dato herrenlose Bären-Insel für das Deutsche Reich zu annektieren, das diese aber gar nicht haben will; zuletzt wünscht er sich für seine Insel ein Nebelhorn, welches nur auf die bloße Existenz des Eilands verwiese und auf sonst nichts - könnte jemand es denn hören. Hochkomisch ist es bei Mosebach oft, wenn er seinen Akteuren Tableaus bereitet, auf denen er sie wie auf einer Bühne aufmarschieren und mit großem Ernst alberne Pirouetten drehen läßt, wenn er die Handlung seitenweise zugunsten von Milieuschilderungen und Figurenbeschreibungen suspendiert, die hinterher für den Plot völlig nutzlos sind, wenn über Welterkenntnis schwadroniert wird, daß es nur so… - aber was schreibe ich mich hier um Kopf und Kragen, lesen Sie doch selbst, wie etwa der Herzog von Mecklenburg sich Gedanken macht über die Spezies des englischen Gentleman: "Für ein Empire brauchte man nicht ein paar herzogliche Dinosaurier - so nannte er sich mit Vergnügen -, sondern tausend, vielleicht hunderttausende Herren, der Herrenstand mußte bis tief in den Mittelstand, bis ins Kleinbürgertum womöglich erweitert werden, um all diese Sepoys und Askaris und Mamelucken und Zuaven und Sherpas im eisernen Griff zu halten. Da kam der Gentleman wie gerufen. Etwa sechshundert Verhaltensmaßregeln wurden dem Mann - irgendeinem Mann, aus der gestaltlosen Menge herausgegriffen - eingebleut, und dann hatte man den Gentleman und setzte ihn auf ein Schiff und verfrachtete ihn mit einem Klavier und einem Schmetterlingsnetz und einem grünfilzigen Kartentisch nach Ozeanien, und dort ließ er es dann England werden. … Und an den langen Abenden gab es ein herrliches Gesellschaftsspiel: beherrschte jeder der Anwesenden die bewußten sechshundert Regeln? Wer einen Fehler machte, war kein Gentleman und mußte ausscheiden." Das Wissen um die historische Verbürgtheit des Stoffes fügt dem Werk im übrigen nichts hinzu; darum berichtet der Autor wohlweislich auch nicht darüber. Es schadet aber auch mitnichten - der "Nebelfürst" gehört sicher zu den besten Büchern des nun schon recht vollständig überschaubaren Jahres. |
|
|














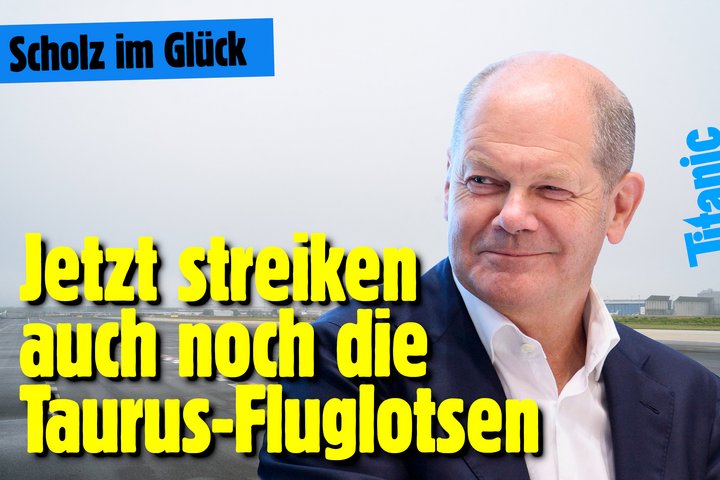

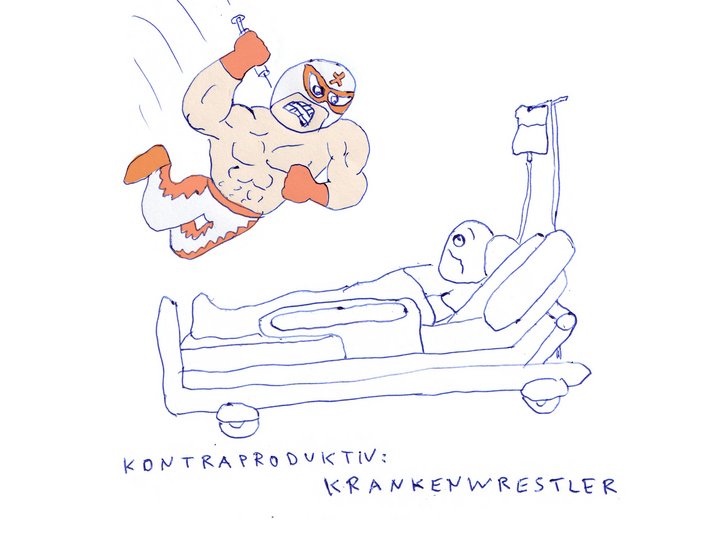


 Nicht zu fassen, »Spiegel TV«!
Nicht zu fassen, »Spiegel TV«!



